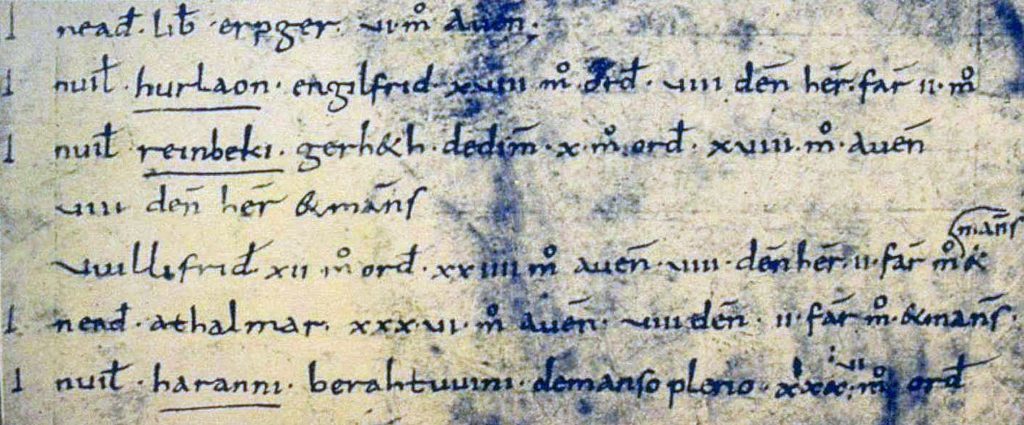Das geheimnisvolle Schicksal eines Parteiarbeiters für die sozialistische Arbeiterbewegung aus Röhlinghausen
Der 05. März 1953: An diesem Tag verkündeten die Nachrichten in der DDR den Tod von Stalin. Tausende von DDR-Bürgern strömten auf der ehemaligen Stalinallee in Berlin zu einem riesigen Trauerzug zusammen. Als Gustav Sobottka von Stalins Tod erfährt, bricht sein Blutkreislauf zusammen. Ein Rettungswagen fuhr den ersten Kohleminister der DDR – wie Gustav Sobottka oft genannt wurde – an dem Trauerzug vorbei in das Regierungskrankenhaus.
Was Gustav Sobottka in diesem Moment nicht wusste: er hat genau noch sechsunddreißig Stunden zu leben. Und der behandelnde Arzt im Regierungskrankenhaus ahnt nicht, das Gustav Sobottka von einem Schock ohnmächtiger und hilfloser Freude ergriffen war. Zu lange hatte er auf diesen Tod gehofft – eine Hoffnung, die er hatte geheim halten müssen.
Zeitzeugen berichteten über den Menschen Gustav Sobottka: „Er war immer unter Angst, das habe ich ja dann als erwachsene Frau mitbekommen, dass die Gustav Sobottkas Anhänger in der SED nicht gut angesehen waren. Das ging ja bis in meine Familie.“
Oder weiterhin: „Herbert Wehner hat in seinen Erinnerungen darauf hingewiesen, dass das persönliche Schicksal von Gustav Sobottka eines der bewegendsten Momente des Terrors, des Opferseins im Stalinismus ist.“
Eine schwer verständliche Feststellung über einen hohen SED-Funktionär der ersten Stunde, der an der Seite von Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Anton Ackermann in der DDR eine sozialistische Gesellschaft aufbauen wollte. Die Lexika in Ost und West geben über ihn wenig Auskunft. Die jahrzehntelang verschlossenen Akten geben um so mehr Auskunft. Mittlerweile sind wichtige Dokumente zur Lebensgeschichte von Gustav Sobottka und seiner Familie einsehbar, nach der Öffnung der Archive in der ehemaligen Sowjetunion und DDR. 1940 galt er in der Sowjetunion als Abweichler. Damals schrieb er Briefe aus dem Moskauer Exil nach Berlin, Briefe, die der KGB und die Gestapo mitlasen.
Er schrieb darin: „Die Geschichte wird erst nach Jahrzehnten, oft erst nach Jahrhunderten geschrieben. Und fast, immer anders, als die Erlebenden sie gedacht haben. So wird auch einmal die Zeit kommen, über die gegenwärtige Zeit richtig zu urteilen.“ (Gustav Sobottka) Eine Redakteurin einer namhaften Sendeanstalt des deutschen Fernsehens übersetzte diesen letzten Satz folgendermaßen: „Ohne konspirative Schminke hieß das: ich könnte wahnsinnig in diesem Land werden.“
Als die Rettungssanitäter Gustav Sobottka im Regierungskrankenhaus am 5.März 1953 über die langen Gänge fuhren, umkreiste ihn eine Frage: Gab die Nachricht von Stalins Tod ihm dem ehemaligen Bergarbeiter aus dem Ruhrgebiet die Freiheit zu berichten, was ihm an Unglück, an Unrecht geschehen war ? Gustav Sobottka kam nicht mehr dazu, seinen Eigensinn zu zeigen, wofür er im Ruhrgebiet in seiner Kampfzeit vor 1933 bekannt war. Am 6. März 1953 schloss sich der Lebenskreis von Gustav Sobottka. Seine Urne wurde in der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friederichsfelde in Berlin-Lichtenberg beigesetzt.
Das Handbuch der deutschen Kommunisten fasst folgendermaßen die Lebensgeschichte von Gustav Sobottka zusammen: Geboren am 12. Juli 1886 in Turowen/Ostpreußen, Sohn eines Dachdeckers und späteren Bergmanns. Seine Eltern gehörten zur religiösen Sekte der Mucker und übersiedelten 1895 ins Ruhrgebiet. Ab 1901 arbeitete Gustav Sobottka auf der Zeche Königsgrube (Röhlinghausen) im Amt Wanne und leistete von 1905 bis 1908 seinen Militärdienst in Düsseldorf. Im Oktober 1909 trat er in den Bergarbeiterverband ein und heiratete Henriette Schantowski (* 9. 3. 1888 – † 15. 9. 1971). Seit Januar 1910 Mitglied der SPD und 1913 Leiter der Partei in Eickel. Im August 1914 zum Militär eingezogen und als Artillerist bis November 1918 im Weltkrieg. Während der Novemberrevolution war er Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates im Amt Eickel. Dann Mitglied der USPD, deren Leiter im Kreis Bochum-Gelsenkirchen, er war Delegierter des Vereinigungsparteitags mit der KPD im Dezember 1920.
Sobottka gehörte zu den Mitbegründern der linksradikalen Union der Hand- und Kopfarbeiter, die einen großen Teil der gewerkschaftlich organisierten Bergleute in ihren Reihen vereinigte. Im Februar 1921 wurde er in den Preußischen Landtag gewählt, dem er ununterbrochen bis 1932 angehörte, und war bis 1925 Vorsitzender der Gruppe Bergbau der Union der Hand- und Kopfarbeiter. Als die KPD 1924/25 die Auflösung dieser Sondergewerkschaft und ihre Überführung in den Bergarbeiterverband beschloss, sträubte sich Sobottka zunächst dagegen und ging zu den Ultralinken. Er blieb aber in der KPD und beugte sich Ende 1925 der Parteilinie.
Schließlich liquidierte er im Auftrag der Zentrale und der Komintern die ultralinke Bergarbeiter-Union, war Delegierter des X. KPD-Parteitags 1925 und des XI. 1927, Mitglied der erweiterten Bezirksleitung Ruhr der KPD. Im April 1928 aus dem Bergarbeiterverband ausgeschlossen, wurde er einer der Mitbegründer der RGO und Mitglied deren Reichsleitung. Im Oktober 1928 übernahm Sobottka die Funktion des Generalsekretärs des Internationalen Komitees der Bergarbeiter bei der RGI und war zugleich enger Mitarbeiter Georgi Dimitroffs im Mitteleuropäischen Büro der Komintern.
Ende 1932 in den Apparat der Roten Hilfe Deutschlands abgeschoben, nicht mehr als Kandidat für den Preußischen Landtag nominiert, emigrierte er im April 1933 zunächst nach Saarbrücken, war Vorsitzender der Internationalen Konferenz der Bergarbeiter und ging 1935 nach Paris. Im November 1935 kam Sobottka nach Moskau, bis Sommer 1936 Stellvertretender Generalsekretär des Internationalen Komitees der Bergarbeiter, anschließend Referent im Zentralrat der sowjetischen Gewerkschaften. Im April 1937 wurden er, seine Frau Henriette und seine beiden Söhne Bernhard (* 30. 6. 1911) und Gustav (* 10. 4. 1915) von den Nazi-Behörden ausgebürgert. Bernhard Sobottka arbeitete nach 1933 illegal für die KPD, saß von August bis Dezember 1933 im KZ. Am 30. März 1943 erneut verhaftet und vom Volksgerichtshof zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Von britischen Truppen aus dem Zuchthaus Hamburg-Fuhlsbüttel befreit, sofort in ein Lazarett gebracht, starb Bernhard Sobottka am 20. Juli 1945 in Hamburg.
Gustav Sobottka jun. (Deckname Hans Boden) , der in Deutschland das Gymnasium besucht hatte, 1929 in den KJVD eintrat, arbeitete nach dem Reichstagsbrand illegal. Am 11. August 1933 festgenommen, saß er bis Ende 1933 in den KZs Oranienburg und Sonnenburg. Dann zu seinem Vater nach Paris emigriert, ging er mit den Eltern 1935 in die Sowjetunion und arbeitete als Schlosser. In der Nacht vom 4. zum 5. Februar 1938 wurde er vom NKWD als Mitglied einer angeblichen Hitler-Jugend verhaftet. Die Eltern wandten sich verzweifelt um Hilfe an Dimitroff und Wyschinski. Doch der Sohn blieb in Haft und kam im September 1940 in einem Moskauer Gefängnis als Opfer der Stalinschen Säuberungen ums Leben.
Henriette Sobottka wurde wegen des Schicksals ihres Sohnes krank und schwermütig. Gustav Sobottka selbst musste aus dem Zentralrat der Gewerkschaften ausscheiden und wurde einer Parteiüberprüfung unterzogen. 1938/39 Mitarbeiter und Redakteur der »Deutschen Zentral-Zeitung« und von Radio Moskau, Oktober 1941 nach Kuibyschew evakuiert, später als Instrukteur in Kriegsgefangenenlagern eingesetzt und ab Juli 1943 Mitglied des NKFD (Nationalkomitee Freies Deutschland).
Am 6. Mai 1945 kehrte Sobottka als Leiter der 3.»Initiativ-Gruppe« (neben der Gruppe Ulbricht in Berlin und der Gruppe Ackermann in Dresden) nach Deutschland zurück. In Stettin stationiert, war er Mitunterzeichner des Aufrufs des ZK der KPD vom 11. Juni 1945, kam Ende November 1945 nach Berlin, wurde in der SBZ zunächst Vizepräsident und im August 1947 Präsident der Deutschen Zentralverwaltung für Brennstoffindustrie. Mit Bildung der DWK 1948 Leiter der Hauptverwaltung Energie und Brennstoffversorgung. Anschließend bis 1951 Leiter der Hauptverwaltung Kohle im DDR-Ministerium für Schwerindustrie, dann nur noch in untergeordneten Funktionen, z. B. für die Schulung im Bergbau verantwortlich.
Gustav Sobottka starb am 6. März 1953. Bedrückt wegen der Ermordung seines Sohnes Gustav in der Sowjetunion und auch der folgenden Krankheit seiner Frau soll er Stalin insgeheim so sehr gehasst haben, dass er über dessen Tod am 5.März 1953 noch jubelte, aber vor Aufregung einen Tag später selbst starb. (Quelle: Hermann Weber, Andreas Herbst: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Berlin, 2004)
Das war gewissermaßen ein Schnelldurchlauf zum bewegten Leben von Gustav Sobottka und seiner Familie. Er selber beschrieb in wenigen Veröffentlichungen, warum diese politische Überzeugung in ihm heranreifte.
Ein Auszug aus einer Veröffentlichung des Dietz Verlages illustriert seine Lebenserfahrung als 16-Jähriger auf der Zeche Königsgrube im Ortsteil Röhlinghausen:
„Als wir im Herbst 1896 in Westfalen ankamen, mietete mein Vater nahe der Zeche Königsgrube in Röhlinghausen, wo fast nur Bergarbeiter wohnten, eine Vierzimmerwohnung und richtete sie mit auf Abzahlung gekauften Betten ein, um Kostgänger zu halten. Das Kostgängerhalten war in diesen Gebieten eine zusätzliche Einnahmequelle, weil der Grubenlohn nicht zum Leben reichte. Und die Kostgänger waren zugewanderte Zechenarbeiter aus Ost- und Westpreußen und Posen, die ohne Wohnung waren und in Kost gingen. Unter diesen Umständen war ich nicht nur „Dienstmädchen“ für die Kostgänger, auch jede noch freie Zeit wurde ausgefüllt mit Kohlenlesen. Statt bei Spiel und Sport, verbrachten wir Kinder diese Zeit auf den Steinhalden nahe der Grube, um die zwischen den Steinen liegenden Kohlenstückchen herauszulesen und damit den Kohlenvorrat für den Winter zu sichern. Wurde wir dabei erwischt, dann mussten die Eltern Strafe zahlen, die höher war als der Preis einer ganzen Tonne Kohle. Der Traum vom schönen Westfalen, von dem die Arbeiter uns so oft erzählt hatten, verflog sehr schnell. Ich verglich unser Leben in Ostpreußen und jetzt in Westfalen und fand den Unterschied nur darin, dass dort die Großbauern und Gutsbesitzer alles hatten und bestimmten und hier die Zechenbesitzer und Zechendirektoren.
Als ich sechzehn Jahre alt war, fing ich auch auf der Grube an. Nach einigen Monaten aber kündigte ich, um auf eine andere Grube zu gehen, weil ich dort als Untertagearbeiter zwei Groschen pro Tag mehr verdient hätte. Doch der Betriebsführer eröffnete meinem Vater, dass auch ihm dann gekündigt würde und dass er die Zechenwohnung räumen müsse. Mein Vater war weit über fünfzig Jahre alt, und Arbeiter in diesem Alter wurden auf keiner Grube neu eingestellt. Dieser Druck genügte, ich musste weiter für zwei Groschen weniger arbeiten. Das alles veranlasste mich, immer mehr über unsere Lage nachzudenken.“
Auf der Zeche Königsgrube erlebte Gustav Sobottka als Jugendlicher die direkte körperliche Gewalt und Züchtigung der Vorgesetzten.
„In späteren Jahren las ich in einem Parlamentsprotokoll, dass die Behauptung, die Bergarbeiter seien vor Streik 1905 schlecht behandelt worden, nicht den Tatsachen entsprochen hätte. So unglaublich das klingen mag, dass Arbeiter im 20.Jahrhundert bei der Arbeit geschlagen wurden, so war es doch eine Tatsache. Als ich 1901 auf der Königsgrube bei Kohlenverladung arbeitete, sah ich, dass der Aufseher bei der Morgen- und Mittagsschicht mit einem Gummischlauch bewaffnet war. Wenn die Jungen auf der Lesebank nicht schnell genug die Steine herunterwarfen oder der Wagen mal überlief, weil ein neuer nicht schnell genug vorgeschoben wurde, dann stürzte er sich auf sie mit seinem Gummischlauch. Dabei kam es oft zu einem Handgemenge, wobei die Jungen, die ja in der Überzahl waren, ihm den Gummischlauch abnahmen und in Stücke rissen. Wurde aber einer von allein erwischt, dann ging es ihm dreckig.“
Und dann als 19-Jähriger erlebte er seinen ersten Streik, als es 1905 zu einem großen Bergarbeiterausstand im Ruhrgebiet kam.
„Anfang 1905 erzählten sich die Bergleute, dass auf der Grube Bruchstrasse bei Dortmund gestreikt würde. Wir Schlepper berieten auf dem Wege zum und vom Schacht, ob wir nicht wie andere Zechen ebenfalls für Erhöhung des Schichtlohns streiken sollten. Um das allen Schleppern, Bremsern und Hauern mitzuteilen, malten wir mit Kreide an die Förderwagen : „Morgen Streik oder 3,80 Mark Schichtlohn.“ Wir erhofften auf der Königsgrube vom Streik auch die Beseitigung der Strafen, die den ohnehin erbärmlichen Lohn noch verminderten. Am nächsten Morgen aber zögerten die Hauer noch. Da legten wir Jungen einen Stempel (Verzimmerungsbalken) so in den Pferdewagen, dass sich der Balken in der Stapelzimmerung verfing und einige Seitenstützen herausriss. Als die Hauer sich aufregten, erklärten wir ihnen: Sorgt dafür, dass wir 3,80 Mark Schichtlohnbekommen, dass wird alles besser funktionieren, und ihr bekommt mehr leere Wagen. Am folgenden Tage streikten im Revier schon sechsundsechzig Zechen. An diesem Morgen ging es auch bei uns los. In die Waschkaue kam der Betriebsführer mit einer Reihe von Beamten, und der Steiger forderte die Bergarbeiter auf, einzufahren. Als schon ein größerer Trupp am Schacht war, erscholl auf einmal eine Stimme, keiner wusste so recht, woher sie kam: „Kameraden, der Zechenverband hat die Forderungen der Bergarbeiter abgelehnt. Deshalb ist für das ganze Revier der Streik beschlossen. Keiner darf heute einfahren!“ – „Streik! Nicht einfahren!“ schrien die Schlepper wie aus einem Munde, und wir rissen die Alten und Wankelmütigen mit.
In unserem Bergarbeiterdorf Röhlinghausen herrschte reges Leben. Auf den Straßen und in den Zechenkolonien standen die streikenden Bergarbeiter. Ein großes Polizeiaufgebot aus Köln, Berlin und anderen Großstädten, zu Fuß und zu Pferde, hielt Straßen und Plätze besetzt. Die Zechenbeamten waren ebenfalls mit Revolvern bewaffnet und durch eine Armbinde als Hilfspolizei gekennzeichnet. Wer nicht zur Arbeit gehen wollte, wurde mit Hinauswurf aus der Wohnung bedroht. Wir jungen Burschen amüsierten uns über die Zechenbeamten, die in der Grube vom Betriebsführer Ohrfeigen erhielten und jetzt mit Revolvern umherliefen und Streikbrecher suchten.
Schon am ersten Streiktage, am 17. Januar 1905, fand die erste Streikversammlung unserer Grube statt. Die Belegschaft, die 1700 Bergarbeiter zählte, war fast vollständig erschienen. Es war meine erste Versammlung. Sie wurde von einem älteren Bergarbeiter, der nicht zu unserer Grube gehörte, eröffnet; denn die Königsgrube war die reaktionärste Zeche, und es hatte sich aus Furcht vor Maßregelung niemand für die Leitung gefunden. Der Redner teilte mit, dass fast das ganze Ruhrgebiet im Streik stände. Von 280 000 Bergarbeitern seien kaum 10 Prozent am arbeiten, die Königsgrube sei die letzte. Die vier Bergarbeiterverbände hätten sich geeinigt, eine gemeinsame Streikleitung gebildet, genannt Siebenerkommission, die mit dem Verein der Zechenbesitzer über die Forderungen der Streikenden verhandele. Gerade die Königsgrube habe im letzten Jahr 43 Prozent Dividende ausgezahlt; die fünf Aktionäre hätten im letzten Jahr drei Millionen Mark verdient. Der Streik ginge um Durchsetzung einer Lohnerhöhung, Beseitigung der Überschichten und des Strafsystems, gegen das Wagennullen, für geregelte Ein- und Ausfahrt. – Die Belegschaftsversammlung machte einen großen Eindruck auf mich.“ (Quelle: „Unter roten Fahnen“-Lebenserinnerungen, Berlin, 1958)
Diese Erfahrungen der Willkür, der Gewalt und der Rechtlosigkeit im Leben der Bergarbeiter und ihrer Familien im Ruhrgebiet ließen bei Gustav Sobottka die Ideen von Marx, Engels, Liebknecht und Bebel auf fruchtbaren Boden fallen. Gustav Sobottka wurde Sozialdemokrat und zeigte das auch offen in Röhlinghausen. Dazu muss man wissen, dass der Bergwerksdirektor und die Steiger manchmal die Butterbrote der Kumpel kontrollierten, um zu sehen, in welchen Zeitungen die Brote eingepackt waren. Das Bochumer Volksblatt als größte SPD-Zeitung im mittleren Ruhrgebiet sorgte dann für großen Ärger.
Sobottka fuhr mit dem Fahrrad durch Röhlinghausen und rief die Kumpel in seinen Garten. Zwischen Karnickelstall und Taubenschlag lasen sie Bebel und Liebknecht. Sobottka zitierte Balladen von Schiller oder Goethe. Der autoritäre Zechendirektor Daniel Bonacker kündigte persönlich Gustav Sobottka seinen Arbeitsplatz und seine Wohnung in der Kolonie. Für die Kumpel wurde Sobottka dadurch zu Legende.
Zurück zu den traumatischen Erfahrungen der kommunistischen Familie Sobottka in der Emigration in der Sowjetunion. Nach der sogenannten Archivrevolution, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, erhielt man Einblick in die Korrespondenzen der Spitzenleute der KPD z.B. mit der Kommunistischen Internationale. Im Folgenden ein längerer Auszug aus einem Brief eines verzweifelten Gustav Sobottka an das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI), nach dem der jüngere Sohn in der Sowjetunion im Rahmen der Stalinschen Säuberungen unter konstruierten „Beweisen“ als Spion verhaftet wurde und in der Haft verstarb. Drei Jahre nach dem Tod von Gustav Sobottka wurde noch zu Lebzeiten von Henriette Sobottka der Sohn Gustav rehabilitiert.
„Brief Gustav Sobottkas (senior)
an das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI) über die Verhaftung seines Sohnes in der Sowjetunion und die Lebenssituation seiner kranken Frau:
Moskau, 22.12.1939
An die
Genossen Dimitroff, Manuilski, Pieck
Werte Genossen!
Am 8. Dezember 1939 musste ich meine Frau in die Heilanstalt für Geisteskranke, Kaschenko, 126 bringen. Sie war seelisch vollkommen zusammengebrochen und sah in jedem Menschen einen Feind. Ich kenne meine Frau seit ihrem 17. Lebensjahr, jetzt ist sie 52. Seit 31 Jahren sind wir verheiratet. Seit 1909 bin ich und seit 1910 meine Frau politisch organisiert und seit Bestehen der Kommunistischen Partei Deutschlands deren Mitglieder. Wir haben als Funktionäre der sozialistischen Arbeiterbewegung manche schwere Zeiten durchgemacht. Nie hat meine Frau irgendwelche Verzweiflung gezeigt; sie stand in allen Kämpfen tapfer an meiner Seite. Im März 1933, als ich auf Wunsch der Komintern Deutschland verließ, setzte sie tapfer als Kassiererin ihrer Parteizelle in Berlin-Oberschöneweide ihre Arbeit fort. Als drei Monate später unsere beiden Söhne verhaftet und ins Konzentrationslager geworfen wurden, auch da ließ sie den Mut nicht sinken.
Durch Zeitungsverkauf erwarb sie sich ihren Unterhalt und unterstützte ihre Söhne im Konzentrationslager. Ja, als ich selbst im Sommer 1933 als Angestellter der Profintern eine Zeitlang keine Geldmittel zum Leben hatte und mich im Saargebiet befand, stellte meine Frau mir ihre Spargroschen zur Verfügung, damit ich meine Arbeit fortsetzen konnte. Im August 1933 wurde sie selbst von den Faschisten verhaftet, doch nach vier Wochen Haft wieder entlassen.
Sofort setzte sie ihre Parteiarbeit fort, bis im April 1934, als ihr die Gestapo den Zeitungsverkauf entzogen hatte und ein zweiter Haftbefehl gegen sie erlassen wurde, folgte sie mir nach dem Saargebiet und später nach Paris. Auch hier war das Leben für sie nicht leicht; der Sprache unkundig, stets auf der Suche nach einer illegalen Wohnung, jeden Augenblick gewärtig zu sein von der Polizei angehalten und verhaftet zu werden, war wenig erfreulich. Doch meine Frau ertrug alles und lies nie den Mut sinken. Als Kommunistin hielt sie fest an ihrer Überzeugung; oft sagte sie: Wir müssen alles durchhalten, einmal wird die Arbeiterklasse siegen, dann wird es auch für alle besser.
Und diese tapfere Frau, die niemals krank war, bricht jetzt verzweifelt am Leben zusammen.
Im Dezember 1935 kam sie mit mir und ihrem jüngsten Sohn nach der Sowjetunion.
Hier fing sie an sofort die Sprache zu erlernen, sodass sie bald besser russisch sprach wie ich. Sie lernte in Sanitätskursen, die im Klub „Ernst Thälmann“ abgehalten wurden, besuchte die Kurse für Parteigeschichte, um ihr Wissen zu vervollkommnen und sich so besser in die Reihen der Sowjetbürger einzureihen. Dasselbe tat unser Sohn. Er arbeitete im Werk NATI. In einem Jahr erlernte er die russische Sprache, besuchte neben seiner Fabrikarbeit die Rabfak und später Abendkurse in einem Moskauer Institut. Es war für uns Eltern eine Freude zu sehen, wie schnell sich der Junge von 20 Jahren in die neuen Verhältnisse einlebte.
Nie beschwerte er sich. Von Kind an als Kommunist erzogen, zeigte er volles Verständnis für manche Schwierigkeiten, die sich hier und da zeigten. Wenn wir zu Hause mal über Arbeitsverhältnisse sprachen, so äußerte er sich stets nur lobend über seine Arbeitskollegen, seinen Meister und die Parteiorganisation des Betriebes. Oft sprach er mit mir oder der Mutter über die Bereitwilligkeit seines Meisters und seiner Arbeitskollegen, die ihm bei der Arbeit halfen, damit er bald das Handwerk des Mechanikers erlerne. Nie hörten wir auch nur ein Wort von ihm, das auch nur einen Zweifel an seiner ehrlichen aufrichtigen kommunistischen Gesinnung zugelassen hätte. Die Mutter war stolz auf ihren Sohn, den sie als einzigen bei sich hatte, während die anderen ihrer zwei Kinder im faschistischen Deutschland verblieben waren.
Dann kam das erste Unglück. In der Nacht vom 4. zum 5. März 1938 wurde unser Sohn verhaftet….
Jetzt steht es seit langem fest, dass mein Sohn unschuldig ist, Mitte September erfuhr ich von dem ersten Sekretär des Woenni Tribunal, Arbatskaja 37, dass die Sache meines Sohnes dort zur Nachprüfung läge. Ich ersuchte einen Advokaten, den Genossen Rusakow, falls ein Prozess stattfindet, vor dem Gericht die Verteidigung meines Sohnes zu übernehmen. Als meine Frau erkrankte, bat ich den Advokaten, da ich selbst nicht hingehen konnte, bei dem Woenni Tribunal nochmals vorstellig zu werden und zu bitten, die Erledigung der Sache doch zu beschleunigen, da von der Entlassung meines Sohnes das Leben meiner Frau abhängt. Am 11. Dezember erhielt ich den Bescheid, dass das Woenni Tribunal keinen Prozess machen könnte, die Sache würde anderweitig entschieden und zwar mit ziemlicher Gewissheit in dem von mir gewünschten Sinne, positiv.
Aber es vergeht Tag um Tag und es wird nichts entschieden. Inzwischen windet sich die Mutter voll Schmerzen und verlangt verzweifelt nach ihrem Sohne. Noch am 18. Dezember sagte mir die Ärztin, dass durch ein Wiedersehen der Kranken mit ihrem Sohne eine entscheidende Wendung in ihrem Zustand eintreten würde. Aber was ist zu tun, wenn die Menschen anstelle des Herzens einen Stein tragen.
Damit Genossen, will ich schließen, ich habe keine besondere Bitte an Sie. Ich wollte Ihnen nur mitteilen das Schicksal eines Parteiarbeiters nach 30jähriger Tätigkeit für die sozialistische Arbeiterbewegung, nach fast 20jähriger Tätigkeit für die Kommunistische Internationale und die Sowjetgewerkschaften.
Mit kommunistischem Gruß
22. Dezember 1939
Gustav Sobottka“1
Norbert Kozicki
Anmerkung
- Hermann Weber, Jakov Drabkin, Bernhard H. Bayerlein, Gleb J. Albert (Hg.): Deutschland – Russland – Komintern, Bd. 2: Dokumente, Berlin: De Gruyter, 2015, Dokument 469, S. 1 573 Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Dietz Verlages Berlin. ↩︎