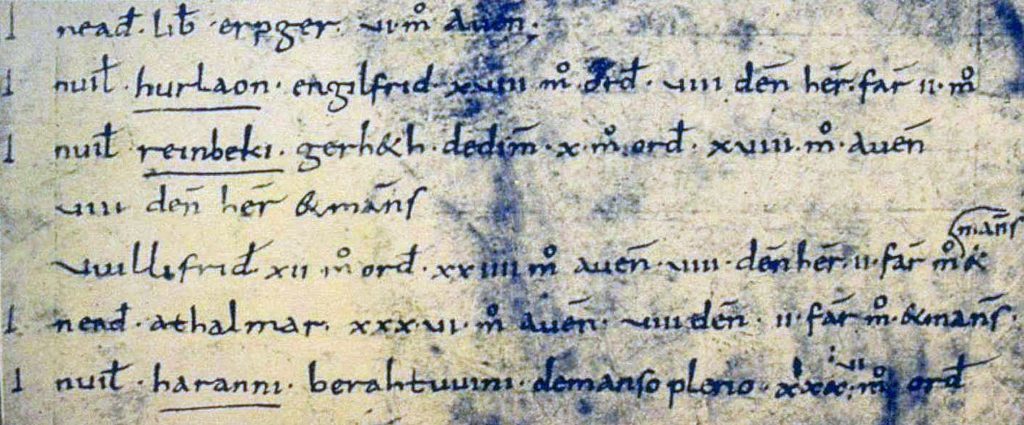„Außerhalb des Ruhrgebiets wird wohl kaum jemand auf den Gedanken kommen, zwischen Stahlwerken und Koksöfen nach einem literarischen Schmelztiegel zu suchen. Das literarische Leben fließt meist an der Ruhr vorbei. Langsam setzt sich das Bewusstsein einer eigenen Sprache durch. Einen richtigen Heimatdichter haben wir aber immer noch nicht und werden wohl auch noch einige Zeit auf ihn warten müssen.“
Mit diesen Worten ging 1966 die Redaktion der Essener Stadtillustrierten auf ein literarisches Lesebuch aus dem Ruhrgebiet mit Beiträgen u.a. von Nicolas Born, Ilka Broll, Ruth Hallard, Martin Kurbjuhn, Michael Lentz, Thomas Rother und Hannelies Taschau ein. „Als erster Versuch ist es zweifellos zu loben, wenn auch von einer gemeinsamen Linie noch keine Rede sein kann.“
23 Jahre später, im Jahr 1989, kann Erhard Schütz in der Zeitschrift Revier-Kultur feststellen: „Literatur im Ruhrgebiet ist keineswegs nur, nicht einmal vorwiegend Literatur der Arbeitswelt. Hier gibt es, wie anderswo, alle erdenklichen Genres – Lyrik zwischen Spruch und Sonett, Dramatik zwischen Revue und Monolog, Prosa zwischen Kurzgeschichte und Autobiografie, zwischen Jugendbuch und Krimi.“
Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Lebensentwürfe der Menschen in der jeweiligen Region. Auch im Bereich der Literatur lässt sich während der 1960er Jahre beobachten, dass sich die Perspektiv- und Orientierungsprobleme der Menschen im Revier zunehmend in verstärkter kultureller Eigenproduktion ausagiert. Da, wo die identitätsbildenden Aspekte der Lohnarbeitsgesellschaft nicht mehr greifen, sucht der Betroffene nach neuen Wegen zur Entwicklung seiner Individualität und Persönlichkeit. Dieser Vorgang modifiziert die Selbstwahrnehmung der Region.
Max von der Grün beschreibt diese Veränderung in seiner persönlichen Biografie. Als er 1951 von Oberfranken ins Ruhrgebiet übersiedelte, wusste er kaum etwas über die Region zwischen Ruhr und Lippe. „Ich hielt sie, schließlich trug ich im Koffer die Vorurteile mit mir, für kulturfremd und von der Literatur nicht einmal angehaucht; klar, wo Fabriken, Stahlwerke und Zechen das Bild einer Landschaft prägen, bleibt für Literatur kein Platz.“
Erst acht Jahre später erhielt Max von der Grün durch die Begegnung mit Fritz Hüser, dem Leiter des Archivs für Arbeiterdichtung und sozialer Literatur – dem einzigen in der Bundesrepublik – Einblick in die kulturelle Wirklichkeit des Reviers. Über diese Wirklichkeit las man wenig bis gar nichts in der bürgerlichen Presse, die mit einer gehörigen Portion Arroganz die kulturellen Leistungen im Revier ignorierte.
Dazu gesellte sich die Tatsache, dass viele Kulturschaffende die Region Ruhrgebiet in Richtung der vermeintlichen Metropolen verließen. Die von Lilo Rauner, Hugo Ernst Käufer, Kurt Küther und Richard Lippert geleistete literarische Pionierarbeit während der 1950er und 1960er Jahre erhielt dementsprechend nicht die öffentliche Anerkennung und Auszeichnung, die sie verdient gehabt hätte.
„Die Literatur ins Leben entgrenzen“, lautete das Motto der neuen Schreibbewegungen, die sich Anfang der 1960er Jahre in der Bundesrepublik bildeten. Diese Literaturproduktion von Bergleuten, Hausfrauen, Hochofenarbeitern, Strafgefangenen, Rentnern und Sozialhilfeempfängern entstand durch die Gegnerschaft zur „bloßen Literatur“ der professionellen Schriftsteller. Schreiben sollte mehr sein. Was es genau sein sollte, war dagegen sehr umstritten. Sicher war man sich nur, dass sich Literatur um die wirklichen Dinge des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens kümmern sollte: Schreiben als Lebensform.
Die sogenannten Wirtschaftswunderjahre der 1950er und der frühen 1960er Jahre brachten eine spürbare Entpolitisierung des gesellschaftlichen Lebens mit sich. Die weit verbreitete Gleichgültigkeit und Borniertheit gegenüber der Restauration des Kapitalismus und der militärischen Wiederaufrüstung motivierten sensible Menschen zum Überdenken ihres persönlichen Lebensentwurfs. Die moralische Indifferenz der Wohlstandsgesellschaft, der brutale Erwerbssinn, mangelndes Demokratieverständnis, Konzeptlosigkeit der pädagogischen Institutionen und die Manipulation der monopolähnlich organisierten Publizistik lieferten für diese kulturelle Gegenbewegung die notwendigen Themen.
„Wir aber sitzen in Europa herum, meistens zurückgelehnt, (…)manchmal eine Unterschrift gegen den Atomtod, Komiteearbeit, Idealisten ohne Ideale, Schweitzer und Russell als Säulenheilige ohne Portefeuille. Ehrwürdige Neinsager, die man reden lässt. Der Wirtschaftsminister hat sich durchgesetzt. Die Macht ist in Aktien konzentriert. Wir wärmen uns an Ohnmacht. Jeder ein Tänzer“, rechnete Martin Walser in den 60er Jahren mit der Unverbindlichkeit der literarischen Außenseiterrolle ab.
Kritische Autoren stellten in jenen Tagen so etwas wie das personifizierte schlechte Gewissen der Gesellschaft dar, einer Gesellschaft, die ihre Beteiligung am Hitler-Faschismus und ihre Verantwortung für die Opfer im ungezügelten Konsumrausch verdrängte. Die ältere Generation meinte sich ihrer Vergangenheit dadurch entledigen zu können, indem sie auf jedes politische Engagement verzichtete. Literatur als schöngeistige Rückzugsinsel hatte Hochkonjunktur. Eine weltfremde Naturlyrik eroberte die Bestsellerlisten des Buchmarktes.
Als kulturelle Gegenbewegung entstand Anfang der 1960er Jahre die „eingreifende Literatur“. Neben der Flucht aus der sozialen Verantwortung kritisierten die neuen Schriftsteller die gesellschaftliche Inkompetenz vieler Intellektueller, deren Sprachlosigkeit auf ihre eigene Lebensuntüchtigkeit zurückgeführt wurde. Zum Aspekt der Zukunft und den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen trugen sie kaum etwas bei. Die Wiederentdeckung der sozial und politisch eingreifenden Literatur ging einher mit der Thematisierung des Zukunftsbegriffs. Spontaneität und Beweglichkeit, Kontinuität und Einbildungskraft bildeten die Zauberworte für den Entwurf eines Lebens in einer modernisierten Gesellschaft. Dazu kam die nicht zu unterschätzende Tatsache, dass viele der neuen Generation schreibender Menschen aufgrund ihres Alters nicht das Trauma hatten, am Hitler-Faschismus beteiligt gewesen zu sein.
Dieser Anspruch der Literatur, bedeutsame Aussagen zur sozialen Wirklichkeit und zur zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen, verursachte ein Zurücktreten des Erzählens zugunsten der theoretischen Konstruktion und praktischen Dokumentation. Die Industriereportagen von Günter Wallraff z.B. boten den unmittelbaren Vorteil des Authentischen gegenüber den poetischen Fiktionen des Erzählers. Literatur verlor damit ihre Abgrenzung zur Publizistik.
In diesem Rahmen gründete sich die Dortmunder Gruppe 61 um die Schriftsteller Max von der Grün, Fritz Hüser und Josef Reding, der sich durch seine Kurzgeschichten im Revier einen Namen gemacht hatte. „Als ich damals das Manuskript zu meinem ersten Roman ´Männer in zweifacher Nacht´fertig hatte, suchte ich einen Verleger. Ich habe damals, naiv wie ich war, das Manuskript an sieben Verleger geschickt, von allen sieben Verlagen bekam ich eine freundliche Ablehnung. Dann las ich zufällig einen Bericht über ein Archiv für Arbeiterdichtung und soziale Literatur, das in Dortmund war. Der Leiter dieses Archivs Fritz Hüser. Ich dachte mir, den Mann suchst du einmal auf, sprichst mit ihm. Ich fuhr nach Dortmund und kam mit ihm ins Gespräch. Ich sagte ihm, ich habe ein Manuskript und kriege es nicht unter“, berichtete Max von der Grün über die Ursachen der Gründung der Gruppe 61. Das Gespräch mit Fritz Hüser gestaltete sich überaus erfolgreich: vierzehn Tage später hatte Max von der Grün seinen Verleger.
Die Intensivierung der Kontakte zu anderen Dortmunder Arbeiterschriftstellern ließ die Idee einer organisierten Zusammenarbeit heranreifen. Am Karfreitag des Jahres 1961 war es dann so weit. Walter von Cube kreierte den Namen Gruppe 61. Im Unterschied zur Arbeiterliteratur der 20er Jahre, verzichtete die Gruppe auf den Habitus der politischen Missionierung. Die programmatische Kurzformel der Dortmunder Vereinigung lautete: geistige Auseinandersetzung mit dem technischen Zeitalter im Sinne einer literarisch-künstlerischen Reflexion der industriellen Arbeitswelt der Gegenwart und ihrer sozialen Probleme.
„Durch die Formulierung ´literarische Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt´ war die Gruppe auf ein punktuelles Thema verwiesen, das bisher stiefmütterlich oder gar nicht oder verzerrt behandelt wurde, nämlich die industrielle Arbeitswelt. Das ist ihre Ausgangsposition gewesen, das hat sie mit gelegentlichen Nuancierungen durchgehalten…Die Gruppe hat sich begrenzt auf die Auseinandersetzungen mit der industriellen Arbeitswelt“, beschrieb Josef Reding die anfänglich nüchterne und sachliche Atmosphäre in der Gruppe.
Der Dortmunder Gruppe ging es nicht mehr um die klassische Arbeiterliteratur, sondern um die reflexiv-literarische Beschäftigung mit dem Thema Arbeitswelt. Die literarischen Produkte müssen nicht mehr von Arbeitern verfasst sein. Diese Arbeiterliteratur, die ihren klassenkämpferischen Charakter verlor, schuf die Voraussetzung für die Akzeptanz der Dortmunder Gruppe durch die Literaturkritik und der interessierten Öffentlichkeit. Weiterhin gelang es der Gruppe, sich aus dem Sog jeglicher ideologischer Diskussionen herauszuhalten. Die Arbeit dieser Schriftstellergruppe war durch und durch parteilich, aber nicht parteiisch im Sinne einer politischen Partei der Arbeiterbewegung.
Auf die Frage, was die Autoren mehr verband, eine primär politische oder eine primär literarische Absicht, antwortete Josef Reding: „Wenn ich glaube, ich müsse einen Tatbestand, der dem Arbeiter negativ zu schaffen macht, herauskristallisieren, dann werde ich auch die literarischen Mittel dafür finden.“
Die Aufbruchstimmung der späten 1960er Jahre ließ viele Arbeiterinnen und Arbeiter im Revier den Mut fassen, eigene Texte über ihr Leben zu verfassen. Diese schreibenden Menschen versuchten Kontakt und Anschluss zur Gruppe 61 zu finden. Doch die Dortmunder konnten ihrem Selbstverständnis entsprechend und von ihrer Arbeitsweise her das vorhandene Potential schreibender Werktätiger nicht zusammenfassen oder gar qualifizieren und zum Selbstausdruck bringen. Einige der Gruppenmitglieder, wie z.B. Josef Büscher entschlossen sich, von diesem Konzept abzuweichen, um anderen Autoren mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Als Büscher die Erfahrung mache, dass die Mehrheit der Schriftsteller in der Gruppe 61 diese kulturpädagogische Funktion nicht ausfüllen wollte und konnte, rief er in Gelsenkirchen eine Schreibschule ins Leben. So entstand 1967/68 die Literarische Werkstatt Gelsenkirchen als praktische Kritik der etablierten Dortmunder Gruppe, aus der im Jahr 1970 der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt entstand.
Die Spiegelrunde konfrontiert Rudi Dutschke mit dem Mond von Wanne-Eickel
„Der Arbeiter fing an zu lesen, weil er begriff, dass Unwissenheit die Ausbeutung förderte. Vor diesem Hintergrund ist es nur zu verständlich, dass sich gerade im Ruhrgebiet immer wieder literarische Gruppierungen bildeten und nach kurzer Zeit auch wieder von der Bildfläche verschwanden, auch deshalb, weil es in dieser Region niemals ein kulturelles Zentrum gab.“ (Max von der Grün)
Eine dieser literarischen Gruppierungen war die Wanne-Eickeler Spiegelrunde. 1959 sammelte Hans Bernd Hellerbach einen Kreis von interessierten Arbeitskollegen um sich, der sich mit Literatur, Philosophie und Religion intensiv beschäftigte: Paul Stöpel, Karl Berthold und Fred Neuenhofer. Die Zukunftsfragen der Menschheit standen dabei für die Kumpel im Vordergrund, die sich alle auf der Wanne-Eickeler Zeche Pluto kennengelernt hatten.
„Im gewissen Sinn bildeten wir eine Notgemeinschaft von Bergarbeitern, die Gedichte und Kurzgeschichten schrieben. Durch diese Gruppe haben wir viel gelernt. Einmal las ich in der Zeitung, …moment einmal, auf der achten Sohle arbeitet jemand, der Gedichte schreibt…, und dann haben wir uns kennengelernt“, erinnerte sich Fred Neuenhofer, der 1959 als Strebführer unter Tage beschäftigt war. Im Laufe der Zeit gesellte sich der Student Friedrich Karl Scheer dazu, der als „Nichtarbeiter“ in der Spiegelrunde eine bestimmte Rolle spielen sollte.

Ausgehend von den literarischen Arbeiten des bereits verstorbenen Wiener Musikpädagogen Josef Tupy, entwickelten die Wanne-Eickeler die philosophischen Grundlagen ihres Werks und ihres sozialen Zusammenlebens. Ziel war es, an der Befreiung des Menschen geistig mitzuwirken. Sie entwickelten ein Modell eines zukünftigen menschlichen Zusammenlebens auf der Basis neuer sozialer Lebensformen. Ihre Beweggründe: Sie litten an der Kulturarmut und Kulturfeindlichkeit ihrer Arbeitswelt.
Diese philosophisch reflektierenden Männer trafen sich mehrere Jahre im Verborgenen. An jedem Sonntagvormittag, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, versammelten sie sich zum Gedankenaustausch. Ausgehend davon, dass das gesprochene Wort zu schnell wieder vergessen wird, brachte die Spiegelrunde ihre Gedanken, Empfindungen, Thesen etc. zu Papier, bis sich über 5.000 Schreibmaschinenseiten Material angehäuft hatten. Es gab kein politisches, menschliches und philosophisches Thema, das nicht diskutiert wurde.
Die Begriffe Versöhnlichkeit, Elektiv und Übermensch spielten die zentrale Rolle in ihrer Zukunftskonzeption. Hinter dem „verdächtigen“ Begriff des Übermenschen verbirgt sich nichts anderes als die Gemeinschaft, das Elektiv als Gruppe von tätigen Menschen, die über eindringliche und nachhaltige Gruppendiskussionen ihre geistigen und persönlichen Fähigkeiten steigern.
„Wer Versöhnlichkeit erwerben will, muss in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten die Versöhnlichkeit zu verwirklichen suchen. Immer wird das Elektiv vom Experiment auszugehen haben. Das Heilmittel war gefunden und tat in der Gruppe seine Wirkung. Das Individuum überwand sich selbst und gelangte in die nächsthöhere Seinsform… Eine kleine Gruppe von Arbeitern ist aus der Bedrückung erlöst, zur Ganzheit zurückgeführt, vom Geist aus seelischer Not befreit“, formulierten die ehemaligen Bergarbeiter.
Dieses soziale und literarische Experiment nahm die Suche nach neuen Formen des menschlichen Miteinanders vorweg, wie sie in späteren Jahren aus der Schüler- Lehrlings- und Studentenbewegung unter dem Stichwort „politische Aufklärung und subjektive Emanzipation“ bekannt wurden. Das Wanne-Eickeler Elektiv entwickelte bereits innovative Begriffe und Konzepte, die in den 1980er Jahren in der politischen Öffentlichkeit diskutiert wurden. Ein Beispiel dafür sind ihre geldtheoretischen Reflexionen, die zwischen verschiedenen Geldbegriffen unterscheiden: Zivilisations-, Kultur- und Lobgeld. Das Zivilisationsgeld sollte jeder Mensch gleich bekommen, um seine soziale und wirtschaftliche Existenz absichern zu können. Ohne Ansehen der Person sollte jeder 1.000 Mark monatlich erhalten. Heute nennt man das das bedingungslose Grundeinkommen.
„Wir haben auch geistigen Striptease gemacht. Das war ganz schlimm. Bekenntnisse zum anderen wurden abgelegt und die persönlichen Fehler schonungslos benannt. Es gab zermürbende Gespräche auch über das Seelenleben.“ In der Gruppe selbst unterschied man zwischen Schreib- und Lebwerk, d.h. auch diejenigen, die nicht schrieben, trugen ihren legitimen Anteil zur Literaturproduktion bei.
1964: „Wir hatten damals eine große Auseinandersetzung und wollten Schluss machen… Da haben wir dann gesagt, wir werden diesem Professor Benz unsere Forschungsergebnisse vorlegen. Wenn er uns ablehnt, dann machen wir Schluss. Bejaht er uns, dann machen wir weiter“, berichtet Spiegelrunden-Mitbegründer Paul Stöpel. Der angeschriebene Universitätsprofessor aus Marburg, der sich mit ähnlichen philosophischen Fragestellungen in seinen zahlreichen Publikationen beschäftigte, reagierte begeistert. Ein halbes Jahr später erhielten die Wanne-Eickeler Bergleute einen Brief aus Marburg.
„Es ist mir erst an der intensiven Reaktion ihres Kreises klar geworden, welche große Verantwortung ich auf mich geladen haben mit der Eröffnung der Übermenschdiskussion… Aus diesem Grund erscheint mir ein literarischer Kontakt mit Ihnen nicht möglich oder sinnvoll zu sein. Ich möchte Sie persönlich kennenlernen, gez. Professor Benz.“
Dieses Schreiben elektrisierte förmlich die Diskutanten der Spiegelrunde, die sich nach jahrelangen intensiven Auseinandersetzungen am Ziel ihrer Wünsche sahen. Professor Benz lud zwei Vertreter der Runde zu einer Tagung nach Wiesbaden ein. Das Los fiel auf Hans Bernd Hellerbach und Paul Stöpel.
„Ich werde das nie vergessen, als er uns in Wiesbaden auf dem Bahnhof empfing. Wir sitzen im Wartesaal erster Klasse. Er kommt rein und sagt ´Also meine Herren´- wir hatten uns noch gar nicht begrüßt – ´sagen Sie mal, wie sind sie eigentlich auf die Begriffe der Versöhnlichkeit und des Elektivs gekommen? Seit 50 Jahren suche ich danach“, erzählt Paul Stöpel, noch heute sichtlich bewegt von der ersten Begegnung mit Professor Benz.
Bei diesem ersten Treffen in Wiesbaden fragte Professor Benz nach der Rolle der Frauen in der Gruppe. Ob sie denn auch integriert seien? Benz betonte, dass es schon genug Männerclubs gebe, die sich mit gesellschaftlichen Zukunftsfragen beschäftigten. „Die Frauen gehörten einfach dazu“, bemerkten die Vertreter der Spiegelrunde, denn die Mitwirkung der Frauen galt als „notwendige Komplettierung der Voraussetzungen zum Gelingen des sozialen und geistigen Experiments.“
Nach Benz Aufforderung beteiligten sich die Wanne-Eickeler Arbeiterschriftsteller mit ihrem Werk „Möglichkeiten und Grenzen der zukünftigen Entwicklung des Menschen und der Menschheit aus christlicher Sicht“ an einem wissenschaftlichen Wettbewerb der Klopstock-Stiftung Hamburg. Neben den Bergleuten schickten 28 Universitätsprofessoren ihre Beiträge zu diesem Wettbewerb.
„Man höre und staune, als Bergleute hatten wir noch nie etwas veröffentlicht und bekamen von der Klopstock-Stiftung den Förderpreis“, erinnerte sich der 73jährie Fred Neuenhofer. Als Förderpreis erhielten Hellerbach und Co. einige tausend Mark, verbunden mit einer Einladung zur öffentlichen Preisverleihung, die vom Fernsehen aufgezeichnet werden sollte. Während der Preisverleihung übermittelte Benz ein Angebot vom Düsseldorfer Diederichts-Verlag, der diese Schrift publizieren wollte.
Im Düsseldorfer Germania-Hotel besprachen die Wanne-Eickeler mit den Vertretern des Verlags alle wichtigen Detailfragen. Cheflektor Thom machte ein Vorwort von Professor Benz zur einzigen Bedingung. Beim Verlassen des Düsseldorfer Hotels herrschte noch Eitel, Freude und Sonnenschein. Während der Heimfahrt im Zug aber entstand zwischen dem „Spiritus Rector“ Hans Bernd Hellerbach und dem damals noch aktiven Karl Berthold eine fürchterliche Auseinandersetzung über das weitere Vorgehen bei der redaktionellen Überarbeitung der preisgekrönten Schrift.
Statt, wie mit dem Verlag vereinbart, das Manuskript nur redaktionell zu überarbeiten, erweiterten die Autoren der Spiegelrunde ihre Arbeit so umfangreich, dass der Düsseldorfer Verlag ein Paket mit 30 Kilogramm Literatur erhielt. Daraufhin lehnte der Diederichs-Verlag jede weitere Zusammenarbeit ab. Eine riesige Chance war vertan. Möglicher Hintergrund dieses Konflikts innerhalb der Gruppe war jener Vorgang, der durch eine Entscheidung des Westdeutschen Rundfunks ausgelöst wurde. Hellerbach und Berthold bewarben sich bei der Rundfunkanstalt mit eigenen Hörspielmanuskripten. Der WDR lehnte die Arbeit von Hellerbach ab, akzeptierte aber den Text von Berthold. Dieses Hörspiel wurde nie gesendet, weil Karl Berthold sein Manuskript zurückzog, um weiterhin Mitglied der Spiegelrunde bleiben zu können.

„Wenn jemand als Hörspielschreiber zum WDR gegangen wäre, den hätten wir zu der damaligen Zeit ausgeschlossen“, erklärten die damals noch lebenden Mitglieder der Gruppe diese Episode. Die Ideen, die der einzelne zu Papier brachte, wurden im kommunikativen Austausch, im kreativen Miteinander aller Mitglieder geboren, so ihre damalige Auffassung. Vom Leben und Denken in der Gruppe – im Elektiv – ging eine enorme Faszination aus, die alle Individuen lange Zeit mit diesem sozialen Experiment verband.
„Dann haben wir alle möglichen Verlage angeschrieben – immer mit einem Misserfolg. Ein Misserfolg schlimmer als der andere“, resümiert Dr. Friedrich Karl Scheer, der mit einer wissenschaftlichen Arbeit über die Friedensbewegung von 1892 bis 1933 in den 1970er Jahren promovierte. Der Student Scheer vermittelte bei inhaltlichen schwerwiegenden Auseinandersetzungen. Er galt als der Neutrale. Oft zeigte er mögliche Lösungswege auf, um die Kontrahenten wieder zu versöhnen. Seine soziale Existenz ermöglichte ihm, diese für die Gruppe eminent wichtige Rolle zu spielen.
In jenen Tagen träumten die Spiegelrunde-Autoren von einem Leben als freischaffende Schriftsteller. Dieser Traum verband sich mit der profanen Erkenntnis, dass nicht alle gleichzeitig aus dem Lebensenergie fressenden Bergbau ausscheiden konnten. Aus den deprimierenden Erfahrungen mit den etablierten Verlagen zogen die Wanne-Eickeler eine einfache Konsequenz: Die Spiegelrunde gründete ihren eigenen Verlag.
Eine zweite riesengroße Chance bot sich den Wanne-Eickeler Arbeiterphilosophen. Der Cheflektor eines der größten westdeutschen Verlagshäuser, mit überaus interessanten Verbindungen im nationalen Buchhandel, bot seine hauptberufliche Mitarbeit an. Die finanziellen Rahmenbedingungen für seine Anstellung waren bereits geklärt, die Kontakte zur Druckerei hergestellt.
Wieder verhinderten inhaltlich-ideologisch motivierte Diskussionen diese Chance zur praktischen Realisierung eines erfolgreichen Verlagskonzepts. „Der hätte hier die ganze Firma saniert und wir haben ihm die kalte Schulter gezeigt und vegetierten dahin“, meinten übereinstimmend die ehemaligen Mitglieder der Spiegelrunde.
Gertrud Hellerbach sieht diesen Vorgang etwas kritischer: „Natürlich hätte der uns saniert, wenn wir das geschrieben hätten, was der Cheflektor erwartet hätte. Nur, dazu war mein Mann nicht bereit.“
Aus eigener Kraft und mit eigenen finanziellen Mitteln publizierten sie dennoch bis 1971 insgesamt acht Bücher, davon zwei Lyrikbände von Hellerbach, mehrere politische Bücher und ihr gemeinsames philosophisches Hauptwerk „Europa und das Weltgericht“.
Im Gefolge der Studentenbewegung von 1968 versuchte die Spiegelrunde ihre gesellschaftlichen Zukunftsentwürfe auch der politischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Insgesamt erschienen drei politische Bücher: „Aufgabe und Ziel der Gewaltlosen in der Außerparlamentarischen Opposition“, „Demokratische Union: Bewegung und Partei?“ und „Gespräch mit Bonn, deutsche Dauerdiskussion“. Das letztgenannte Werk verschickten die Wanne-Eickeler Aktivisten zum Nulltarif an alle 500 Bundestagsabgeordneten.
Zu Beginn des Jahres 1968 nahm die Spiegelrunde Kontakt zu Rudi Dutschke auf, um mit ihm über die „Bewusstwerdung der Massen“ zu diskutieren. Am 4. Februar 1968 stand in den Katakomben der Wattenscheider Stadthalle Hans Bernd Hellerbach vor Rudi Dutschke und überreichte ihm persönlich den Lyrikband „Der neue Mond von Wanne-Eickel“ und forderte ihn zur Auseinandersetzung auf. Dutschke versprach eine schriftliche Reaktion auf die von der Spiegelrunde entwickelten politischen Vorstellungen. Das Attentat auf Dutschke vom 11. April 1968 verhinderte diesen geplanten Dialog.
- Buchcover ‚Der neue Mond von Wanne-Eickel oder Hyperion im Hades, Repro Norbert Kozicki
- Buchcover ‚Der neue Mond von Wanne-Eickel‘, Repro Norbert Kozicki
- Buchcover ‚Der Neue Mond‘, Repro Norbert Kozicki
In den Jahren der Studentenbewegung und des politischen Aufbruchs intensivierten die Mitglieder der Spiegelrunde ihre Kontakte zu anderen Gruppierungen. Gegen Ende des Jahres 1967 erhielten die Wanne-Eickeler Autoren eine Einladung zum Collegium Humanum von Dr. Haverbeck in Vlotho, wo sie im Rahmen einer Vortragsreihe ihre Grundgedanken zu einer Philosophie der Arbeit vorstellten. Zu den Teilnehmern der Tagung zählten auch Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann aus der Berliner Politszene.
Angesprochen auf die Kontaktmöglichkeiten in der Literaturszene der späten 1960er Jahre skizziert Gertrud Hellerbach: „Zu den Leuten um die Gruppe 61 zu Richard Limpert und Josef Büscher versuchte mein Mann mehrmals Kontakt aufzunehmen. Doch ihre Herangehensweise war meinem Mann zu eng gefasst. Die wollten knallharte Arbeitergedichte machen. Mein Mann verstand sich mehr als Arbeiterphilosoph.“
Am 8. Februar 1968 organisierten die Herausgeber der offensiven Studentenzeitung „Ruhr-Reflexe“ eine Podiumsdiskussion zum Thema „Politische Dimension einer Arbeiterliteratur heute“ mit Max von der Grün und Fritz Hüser. Als wesentliches Ergebnis dieses Abends galt die Erkenntnis, dass die Literatur der Arbeiterschriftsteller hoffähig geworden war, denn die anerkannten Autoren veröffentlichten ihre Werke in bürgerlichen Verlagen. Im Rahmen dieser Diskussionsveranstaltung meldete sich auch eine „Minderheit“ zu Wort, die die Gründung eigener, revolutionärer Verlage dringend empfahl.
Es waren die Autoren der Spiegelrunde, deren Sprecher an diesem Abend erklärte: „Hier wurde von verschiedenen Arbeiterdichtern gefragt, was wir denn tun können? Die bürgerlichen Verlage achten uns nicht und ihre Lektoren legen Maßstäbe an, die uns nicht gemäß sind, die oft nur vom rein Ästhetischen her gesetzt sind. Laufen wir ihnen nicht länger nach. Wir Arbeiter können etwas tun, und wir haben bereits etwas getan. Vier Bergleute haben mit einem Studenten und einigen Hausfrauen gemeinsam einen Verlag gegründet. Wir können nur hoffen, dass uns auch die Arbeiterschaft unterstützt.“
Diese Hoffnung der Spiegelrunde erfüllte sich nicht. Die Konflikte innerhalb der Gruppe häuften sich, so dass bald keine Versöhnung mehr möglich war. Im Endstadium dieses sozialen Experimentes blockierten sich die Gruppenmitglieder gegenseitig. Der Vorrat an positiven Erfahrungen und gemeinsamen Erlebnissen, die die Autoren und Ideenproduzenten – ungeachtet der seelischen Verletzungen, die das Individuum letztlich davontrug – an die Gruppe kettete, war zu Beginn des Jahres 1971 erschöpft. Die Spiegelrunde löste sich auf. Die umfangreichen Restbestände des Verlags lagern heute in einem sanierungsbedürftigen Altbau an der Gelsenkircher Straße in Wanne-Eickel. Paul Stöpel, heute Bezirksdirektor in der Versicherungsbranche, bringt die Bedeutung der Spiegelrunde für sein persönliches Leben auf den Punkt, wenn er feststellt: „Ja, ich habe studiert, habe ich gesagt, wenn man mich fragte. Aber nicht an der Universität, sondern in der Spiegelrunde!“
Norbert Kozicki
Quelle:
„Die Kinder von Karl Marx und Coca-Cola“ – Kulturelle Streiflichter aus dem Revier der 60er Jahre, Banana Press Verlag Herne, 1990