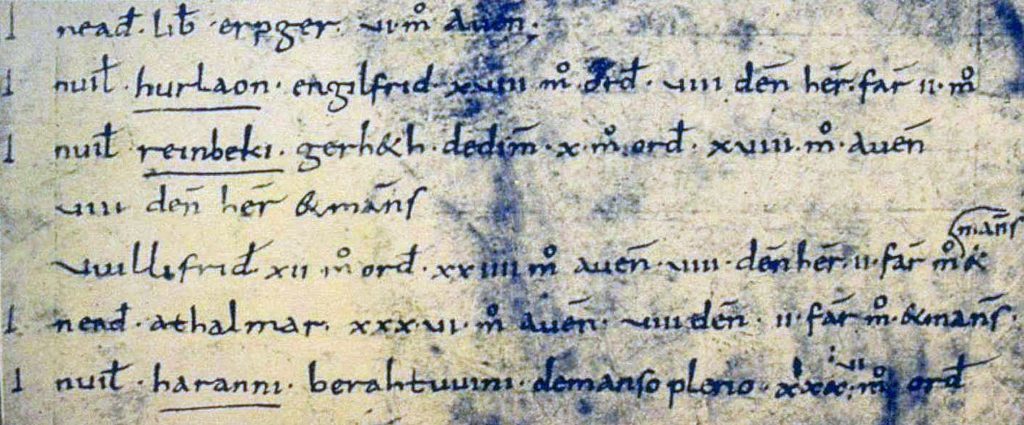Erinnerungen von Werner Blumenthal zur Reichspogromnacht 1938
Im Alter von 83 Jahren verstarb Werner Blumenthal am Vorabend des 9. November 2006. Die deutsche Friedensbewegung trauerte um einen langjährigen Weggefährten und Freund. Auch in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung hatte sein Name einen guten Ruf. Werner Blumenthal war Jude, Deutscher und Kommunist – was für viele Menschen heute immer noch nicht zusammengeht.
Werner Blumenthal überlebte den Faschismus, weil er zu den zehntausend deutschen Kindern jüdischen Glaubens gehörte, die mit den legendären Kindertransporten nach der Reichspogromnacht von 1938 nach England gebracht wurden. Werner Blumenthal half der US-Filmemacherin Deborah Oppenheimer – ihre Mutter war im letzten Kindertransport – über diesen historischen Vorgang einen Dokumentarfilm zu drehen, der im Jahr 2001 mit dem Oscar in den USA ausgezeichnet wurde. In den Kinderlagern von England und Kanada wurde Werner Blumenthal zum Antifaschisten. Im Exil begegnete er bedeutenden Männer und Frauen, deren Namen eng mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden sind. Nach 1945 kehrte er ins Ruhrgebiet nach Herne zurück. „Weil der Antifaschismus Antifaschisten braucht“ war dabei seine Handlungsmaxime. In seiner noch unveröffentlichten Autobiografie schrieb Werner Blumenthal: „Wenn es euch beruhigt: Ich habe nichts zu bereuen.“
In seiner Autobiografie befindet sich ein längeres Kapitel zu jener grauenvollen Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Im Folgenden ein paar Auszüge, beginnend mit einer Szene aus dem Transportzug der Kinder nach England.
Norbert Kozicki
Der 10. November 1938 . . .
Die Stimmung der Jungen und Mädel im Zug war zunächst gedrückt. Man hatte gelernt, seine Gefühle im Zaum zu halten, nicht zu deutlich zu zeigen, was man dachte. Vor allem waren sie ein wenig verwirrt über all das, was da auf sie einstürzte. Immerhin war es ein großes Erlebnis: raus aus der Schule oder Lehre, aus dem Elternhaus, dem täglichen Einerlei. Man trat eine große Reise an – ohne Eltern und Geschwister, noch dazu ins Ausland, außerordentlich ungewöhnlich in jener Zeit. Und wie glücklich ist es von Natur aus eingerichtet, dass Kinder auch ein ungewisses Erlebnis, das selbst einen tränenreichen Anfang haben mag, als tolles Abenteuer empfinden.
Nun war es also Gewissheit, dass wir in Holland waren. Die Stimmung schlug um. Die Starre fiel ab, machte einem übermütigen Geplapper Platz. Nie wieder gehen wir über diese Grenze zurück, beteuerte man hoch und heilig!! Ein Geschiebe und Gedränge begann in den Gängen der D-Zug-Wagen. Man lief durch den Zug, schaute in die Abteile auf der Suche nach Bekannten.

Da traf ich Hannelore. Sie kam aus meiner Heimatstadt Bochum, aus meinem Bekanntenkreis. Da ich seit Monaten in Berlin lebte, hatten wir uns lange nicht gesehen. Von ihr erfuhr ich, was meine Mutter mir bei ihrem kurzen Abschiedsbesuch nicht gesagt hatte.
. . . in Bochum
Zwar wusste ich bereits, dass Vater und Onkel in das KZ Sachsenhausen bei Berlin „verbracht“ worden seien, auch Kurts Vater. Aber so schrecklich wie heute klang das damals noch lange nicht in meinen Ohren. Nach dem „Warum“ zu fragen, hatte ich aufgegeben. Weder Mutter noch sonst wer hatte darauf eine Antwort. Politik war nie ihr Metier. „Das ist eben der ,Risches‘, der Antisemitismus, „die haben was gegen Juden.“ Das musste als Antwort genügen. Dass schon zu dieser Zeit die KZs voll waren mit vorwiegend nichtjüdischen Hitlergegnern und Widerständlern, dass man Tausende von ihnen bereits ermordet hatte – darüber fiel kein Wort.
Hannelores Bericht im Zug war nüchtern und plastisch. Sie erzählte davon, wie es ihr ergangen war, ihren Eltern. Sie sprach von Bekannten, die von der SA zusammengeschlagen wurden; vom „Schammes“, dem Synagogendiener, berichtete sie, der mit seiner Familie nur mit Mühe und Not den Flammen entkommen war – und, und, und.
Mutter hatte mir ja auch erzählt, dass sie zurzeit bei Freunden, bei Alfred und Grete in der Brüderstraße wohnten. Warum – das hatte sie nicht gesagt. Weil eben die Männer alle fort sind, dachte ich. Meine Bochumer Bekannte klärte mich auf: „Die haben doch auch bei euch zu Hause alles kurz und klein gehauen.“
*
Unser Zuhause, das war die Wohnung in der Neustraße 22, erste Etage. Das Haus lag an der Ecke zur Kreuzstraße, gleich an der Hermannshöhe, der Brücke über die vielbefahrene Eisenbahnlinie. Die Wohnung war von „gut bürgerlicher“ Art, dem sozialen Stand meiner Eltern angemessen, die bei ihrem Einzug dort relativ wohlhabend gewesen sein müssen. Da ich selbst kaum Wohnungen anderer Art kennenlernte, war sie für meine damaligen Begriffe „normal“, nichts Besonderes.
Die Wohnung bestand aus sieben Zimmern, plus Küche, Bad, Gästeklo und einem langen Korridor. Außer meinen Eltern, meiner Schwester Lore und mir lebten auch Mutters Vater und Vaters Bruder Hermann bei uns.
In dem langen Korridor, von dem die Türen in die einzelnen Zimmer führten, lag ein Teppich über die ganze Länge und Breite. Hier gab es immer besonders Getöse, wenn Lumpi, der Hund meines Onkels Fritz, bei uns zu Besuch und in die Wanne gesteckt worden war, sich auf dem Teppich trockenrieb. In der Mitte des Ganges hatte Vater uns an der Decke Haken befestigen lassen, an denen Leinen für eine Schaukel, ein Reck oder Ringe befestigt werden konnten. Oft und gerne schaukelten wir hier und „turnten“, taten das, was wir und unsere Freunde darunter verstanden. Immerhin habe ich trotz alledem nie auch nur einen einigermaßen vorschriftsmäßigen Klimmzug geschafft. Meistens stellten wir uns Schemel in wachsender Entfernung vom schaukelnden Reck auf und sprangen an das „fliegende Trapez“. Ich kam mir außerordentlich sportlich und mutig dabei vor.
Zur Rechten lag die große Küche. Ein großer, blankgeputzter Kohleherd zierte die eine Wand neben dem Koksofen, der die Etagenheizung versorgte. Daneben lag das Spülbecken. Eine Fenstertür führte auf den Balkon, von dem man in den düsteren und ummauerten Hof blicken konnte. Hier hatten die Mülltonnen und die Teppichklopfstangen ihren Platz. Auf dem Balkon stand die Eistruhe, die regelmäßig mit den viereckigen Eisstangen bestückt werden musste. Der Eismann brachte die schweren Brocken auf der Schulter, die mit einem Gummituch geschützt war. Mittags kam zuweilen der große, drahthaarige Airedale-Terrier hierher auf den Balkon, der nachts im Geschäft Wache zu halten hatte. An seinem Fressnapf dort verstand er keinen Spaß und duldete unsere Nähe nicht. Ansonsten konnten wir Kinder auf ihm reiten und taten das mit Vorliebe. Er wurde eines nachts von Einbrechern vergiftet.
Schräg gegenüber der Küche war Opas Zimmer, etwas düster und schummerig. Ein kleiner Erker zur Straße mit Butzenscheiben-Fenstern und auch die Lampe brachten nicht viel Licht. Die dunklen Schlafzimmermöbel taten das ihrige dazu.
Opa verbrachte hier viel Zeit. Er betete früh und spät, schlief in seinem Sessel und verwahrte sein ganzes Hab und Gut an Wäsche und dergleichen „für Hannemann“, womit ich gemeint war. Pünktlich setzte er seine schwarze Melone auf, zog Rock und Paletot an, nahm Stock und Gebetbuch, um zur Synagoge zu gehen.
Onkel Hermann und ich teilten uns den angrenzenden Raum. Links und rechts an den Wänden standen jeweils unsere Betten. Auch mein Schreibpult hatte hier seinen Platz.
In relativ spitzem Winkel, zwischen Neu- und Kreuzstraße, beherbergte die Hausecke den repräsentativsten und größten Raum, das sogenannte „Herrenzimmer“. Ein etwa ein Meter breiter Balkon mit steinerner Brüstung umzog das ganze Eck. Ein imposanter Schreibtisch stand schräg im Raum, ein ebenso imponierender Bücherschrank beherrschte die gegenüberliegende Wand. Um einen runden, schweren Tisch in der Mitte des Zimmers gruppierten sich vier mächtige Ledersessel. Passend zu den dunkelgebeizten Möbeln hing ein mächtiger Leuchter darüber. Dieser Raum diente fast ausschließlich der Repräsentation, wurde nur bei Besuch oder bei Festlichkeiten benutzt. Als ich dreizehn wurde, bekam ich feierlich den Schlüssel zum dortigen Bücherschrank ausgehändigt. Der passte aber auch zum Mittelteil, in dem Vaters „Schwarzwälder Kirsch“ und ähnliche heiße Sachen standen, von denen ich natürlich naschen musste. (Pfui, schmeckte das gut!!?)
Der weite Durchbruch zum angrenzenden „Damenzimmer“ konnte mit einem schweren Vorhang abgegrenzt werden. Dieses Zimmer war mit grüner Stofftapete ausgeschlagen. Die Sessel, Tische und Vitrinen hier waren von zierlicherer Art als die für die „Herren“. Hier war auch das Klavier untergebracht, an dem ich – zu meinem heutigen Leidwesen – nur sehr ungern die verordneten Lern- und Übungsstunden absolvierte.
Weiter ging es ins Esszimmer. Dies besaß einen Erker, zu dem eine Stufe hinaufführte, dessen Fenster wiederum Butzenscheiben hatten. Eine mächtige braune Kredenz füllte die eine Stirnseite, ein Ausziehtisch mit hochlehnigen Stühlen stand in der Mitte. Darüber schwebte weit auskragend ein Lampenschirm mit Fransen und Bommeln. Später kam auch Lores Bett in dieses Zimmer. Hier stand auch unser erstes Radio, ein Kristalldetektor mit Kopfhörer, der später von neuzeitlicheren Modellen abgelöst wurde. Auch Kanarienvogel Hansi und der Wellensittich hatten hier ihren Platz.
Schließlich ging es hindurch zum Elternschlafzimmer. Die Möbel waren aus poliertem Mahagoniholz. Vor den breiten Betten die Frisierkommode mit langen Spiegeln. In dem dekorativen Wäscheschrank herrschte mustergültige Ordnung. Die Bett- wie Leibwäsche war schnurgerade über- und nebeneinander gestapelt und mit Bändchen versehen. Mutter betrachtete dies als ihre ureigene Visitenkarte.
Besonders in den letztgenannten Zimmern hingen Gemälde und Bilder aller Art, doch ich kann mich an kein einziges davon wirklich erinnern.
Zwischen Esszimmer und Korridor, auf der zum Hof führenden Wohnungsseite, lag das geräumige Badezimmer. Toilette und Bidet standen hier neben der Badewanne und einem dreiteiligen, marmornen Waschtisch. Über die ganze Länge zog sich ein Spiegel.
Eine zweite Toilette befand sich zwischen Bad und Küche, vom Korridor erreichbar. Davor lag die geräumige Garderobe. In diese fensterlose Nische zog uns Mutter regelmäßig, wenn ein Gewitter aufkam – sei es bei Tag oder bei Nacht. Sie hatte panische Ängste vor diesen Naturgewalten, holte uns aus dem Schlaf und ließ uns hier, wo Blitze kaum wahrnehmbar waren, beten und ständig wiederholen: „Lieber Gott, beschütze uns!“ Kein Wunder, dass sich ihre Gewitterangst für lange Zeit auf uns übertrug. Sie selbst hat sie nie verloren.
Das sogenannte Arbeitszimmer lag gleich neben der Wohnungstür, der Küche gegenüber und hat vormals zur Nebenwohnung gehört. Ich erinnere mich, wie der Maurer den Durchbruch machte, die alte Tür nach nebenan zumauerte und bei uns eine neue einsetzte. Mitten in diesem Raum stand ein überdimensional großer Tisch. In diesem Zimmer stellten wir unsere Fahrräder ab, fuhren oft voller Übermut per Rad um den Tisch herum, der uns auch zum Tischtennisspielen diente. In diesem Raum durfte ich auch mit meinem Luftgewehr spielen. Eine großflächige Wandtafel war angebracht, auf der Zielscheiben befestigt werden konnten. Vater machte es besonderen Spaß, mit mir um die Wette zu schießen, z. B. rückwärts über die Schulter mittels eines Spiegels. Mit meinem Freund habe ich allerdings auch auf runde Schachteln geschossen, in denen – wie sich herausstellte – Mutters Hutkollektion ruhte.

Der eigentliche Zweck des Raumes war ein anderer: Nachdem Mutter nicht mehr im Geschäft mitarbeiten und -verdienen konnte, aber zum Haushaltsetat beitragen wollte (oder musste?), versah sie hier weiße Leinen- oder Baumwolltischtücher mit blauen Vordrucken für Stickarbeiten. Und das ging so: Die Vorlagen selbst wurden auf breiten Bögen von milchigem Pergamentpapier geliefert, das zu langen Rollen aufgewickelt war. Vater setzte sich damit an die Nähmaschine und „nähte“ die Muster nach, d. h. versah die Striche und Linien mit feinen Löchern. Ein mühseliges Unterfangen, das viel Geduld erforderte. Die fertigen Schablonen wurden nun über die Decken gelegt, beschwert, damit sie nicht verrutschten, und mit einem Filz wurde blaues Farbpulver darüber verrieben. Eine Art Siebdruck. Dieses Pulver bildete so das gewünschte Stickmuster auf der Decke, wurde anschließend mit einer Handpumpe mit Spiritus besprüht, um die Farbe zu fixieren. Für Mutter war das alles recht anstrengend, zumal sie sich als kleines Persönchen immer weit über die große Tischfläche zu beugen hatte. Ob die Arbeit was eingebracht hat, kann ich nicht sagen. Doch sie machte sie noch, als ich nach Berlin ging.
Und nun war nichts mehr von alledem geblieben.
*
Als in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 die Nazi-Kohorten den verordneten „Volkszorn“ gegen die Juden vollzogen, in jener Pogromnacht ging auch in Bochum nicht nur die Synagoge nebst angrenzender jüdischer Volksschule in Flammen auf. Nicht nur die Geschäfte jüdischer Eigentümer wurden zerstört – wie auch das kleine Etagengeschäft für Kurzwaren, das Vater und Onkel sich geschaffen hatten, nachdem das von ihnen geleitete Kaufhaus „Heymann & Co.“ (ehem. Gebr. Koppel) „arisiert“, also „Ariern“ zwangsübereignet worden war. Auch zahlreiche Wohnungen wurden ausgeplündert und zerstört. So auch die unsrige. Sie war im Anschluss daran nicht mehr bewohnbar. Ein ehemaliger Angestellter meines Vaters hatte den SA-Sturm befehligt und angeheizt, der unsere Wohnstatt in einen Trümmerhaufen verwandelte. Einrichtungsgegenstände flogen aus den Fenstern, die Trümmer wurden auf der Straße angezündet; Wäsche, Schmuck und sonstiges von Wert wurde geplündert. Ein Wunder, dass Mutter, Schwerster und der taube Opa heil davon gekommen waren.
In einer schriftlichen, eidesstattlichen Erklärung meines Vaters an die Bochumer Polizei aus dem Jahre 1948 – also erst zehn Jahre danach –, konnte ich authentisch erfahren:
„In der Nacht des 9. November 1938 drangen ca. 15 mir unbekannte Nazis gewaltsam in meine Wohnung ein. Zwei dieser Männer holten uns unter Drohungen aus der Wohnung heraus und befahlen uns, mit dem Gesicht zur Wand im Treppenhaus stehen zu bleiben. Es erging ein kurzer Befehl und darauf drang die ganze Horde mit Beilen, Hämmern und Äxten in meine Wohnung ein und innerhalb weniger Minuten waren sämtliche Räume völlig zertrümmert, die Wohnung sämtlicher Wertgegenstände und Bargeld beraubt. Wäsche, Porzellan und Silbergegenstände wurden aus dem Fenster auf die Straße geworfen. . . .
Wie bereits vorhergesagt, waren mir die Männer, welche Zivilkleider trugen, unbekannt. Lediglich der Leiter und Anführer der Horde war ein gewisser SA-Mann S., früher wohnhaft . . . . – S. war früher Angestellter meiner Firma. Ich erkläre hiermit, dass ich selbst gehört habe, dass die gesamte Horde lediglich auf die Anweisungen und Befehle des S. gearbeitet hat.“
In einer Aufstellung, die mein Vater über „zertrümmerte bzw. geraubte Gegenstände“ machte, geht u.a. hervor:
- Schlafzimmer, bestehend aus . . zertrümmert
- Lampe aus Marmor . . zertrümmert
- Goldene Herrenuhr . . gestohlen
- Bargeld aus verschlossener Kassette. . gestohlen
- Perlenkette. . gestohlen
- Esszimmer, bestehend aus . . zertrümmert
- Klavier . . zertrümmert
- Sofa, 2 Sessel, Tisch und Stühle . . zertrümmert
- Kronleuchter aus Bronze . . zertrümmert
- Schreibmaschine . . gestohlen
- 2 große Gemälde, 3 kleine u. 8 Aquarelle . . zerschnitten
- Essservice (72-teilig), Kaffeeservice (52-teilig)
- Kristallgläser, sämtliche Nippes . . zertrümmert
- Bücherschrank, Schreibtisch, Ledersessel . . zertrümmert
- ca. 500 Bücher, zwei Briefmarkensammlungen . . aus dem Fenster geworfen und gestohlen
- Gesamte Badezimmereinrichtung . . zertrümmert
Und so weiter.
Aufgrund der Verordnung über die abzugebenden Wertstücke aus jüdischem Vermögen wurden Schmuckstücke und Silberbestecke, Schalen usw. im damaligen Wert von über 10.000 Reichsmark konfisziert. Vater errechnete einen Gesamtschaden von 44.000 RM.
Erst viele Jahre später hat meine Schwester Lore aufgeschrieben, was sie an diesem Tag in der elterlichen Wohnung erlebte. Hier ein Auszug davon:
Ich schreibe diesen Bericht hauptsächlich für meinen Bruder Werner. So oft ich auch versuchte ihm zu erzählen, was damals geschah, konnte ich mein Vorhaben nicht zu Ende bringen.
Zugleich hoffe ich, mir hiermit das Geschehen von der Seele schreiben zu können.
In der Nacht des 8. November 1938, vielmehr in den frühen Morgenstunden des 9. November – es war etwa 2 Uhr – schellte es ohne aufzuhören. Man hatte ein Streichholz neben den Klingelknopf geklemmt. Man versetzte uns zunächst in Schrecken während man noch dabei war, eine andere Wohnung in der Nähe zu demolieren.
Papa forderte Mutti, Opa und mich auf, uns anzuziehen, er und Hermann machten das auch. Die ganze Zeit über schrillte die Klingel und auf der Straße waren eine Menge SA- oder SS-Männer.
Papa brachte Mutti, Opa und mich ganz leise auf den Dachboden und schloss uns dort in einen kleinen Raum ein. Er selbst und Hermann blieben unten in der Wohnung.
Endlich hatten die Nazis ihre Arbeit weiter unten auf der Straße beendet und nun waren wir an der Reihe. Etwa 20 bis 25 SA-Leute jagten Papa und Hermann aus unserer Wohnung ins Treppenhaus. Dort mussten sie mit dem Gesicht zur Wand und hoch erhobenen Händen stehen bleiben. Die SA-Leute trugen alle hölzerne oder stählerne Knüppel bei sich. Ob sie Papa oder Hermann geschlagen haben, weiß ich nicht. Keiner von beiden hätte uns davon erzählt.
Oben auf dem Boden hörten Mutti und ich lautes Krachen und wir zitterten am ganzen Leib. Opa war doch taub und so war es nicht leicht, ihn zu beruhigen, zumal wir uns ihm in der Dunkelheit nicht verständlich machen konnten. Nach den längsten zwei Stunden in unserem Leben wurde es wieder ruhig und Papa kam, um uns zu holen.
Als wir in unsere Wohnung kamen sahen wir, dass alles kaputtgeschlagen war. Überall lag zerbrochenes Glas.
Papa sagte zu Mutti: Alles ist ruiniert. Muttis Antwort: Hauptsache, dass dir nichts passiert ist!
Jedes Gemälde war zerschnitten, jedes Einrichtungsteil zerschlagen. Silber sowie Bettwäsche waren aus dem Fenster geworfen, Muttis Schmuck war gestohlen worden. Man konnte sich nirgends hinsetzen, da alles voller Glasscherben war. Wir versuchten ein wenig wegzuräumen, damit Mutti sich etwas hinlegen konnte. Inzwischen dämmerte es schon.
Ich schaute aus dem bleiverglasten, bunten Fenster in Opas Zimmer, wo ich selbst nicht gesehen werden konnte. Von dort aus sah ich, dass die Synagoge brannte.
Gegen 8 oder 9 Uhr vormittags kam wieder eine Horde SA-Leute und verhafteten Papa und Hermann. Sie, wie alle anderen männlichen Juden in Bochum, brachte man auf die Polizeiwache.
An diesem Tag hatten die Kinder schulfrei. Etliche folgten einem SA-Mann, der mal bei uns angestellt gewesen war, und der sie aufforderte, Steine in unsere Wohnung zu werfen und so noch das letzte heile Glas zu zertrümmern. Wir schlossen alle Türen und verbrachten die meiste Zeit des Tages im Flur, damit wir nicht selbst von Steinen getroffen wurden. Da wir die Nacht nicht in der Wohnung verbringen konnten, gingen wir eine Etage höher zu Lyons, die uns erlaubten, in ihrer Küche auf dem Boden zu schlafen. Am nächsten Tag halfen Karl-Heinz und Frau Müller uns bei dem Versuch, aufzuräumen.
Wenige Tage nach ihrer Verhaftung wurden Papa und Hermann in Viehwagen in das KZ Sachsenhausen bei Berlin transportiert.
Erstmals musste Mutti allein die Verantwortung für uns tragen.