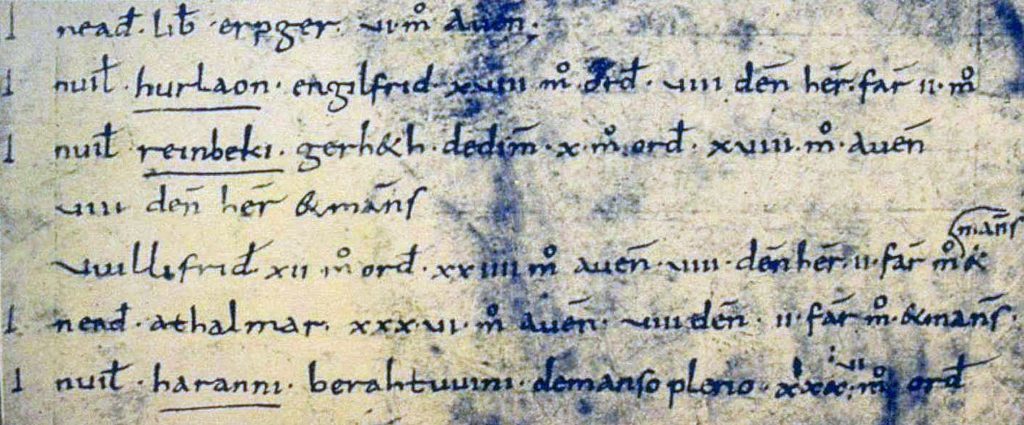Erinnerungen des Bergarbeiters Gustav Sobottka
Den ersten Teil meiner Kindheit verlebte ich in Masuren, dem südlichen Teil Ostpreußens. Mein Vater war Kätner. Das waren Arbeiter, die ein eigenes „Haus“ besaßen und gegen Tagelohn auf Gütern oder bei Bauern arbeiteten. Unser „Haus‘“ war eine von der Familie selbsterbaute Lehmhütte. Mit neun Jahren – das war 1895 – begann ich bereits, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, war ich doch schon „großjährig‘“. Damit ich beim Bauern das Vieh hüten konnte, durfte mich meine Mutter vom neunten Lebensjahr ab jeweils von April bis Oktober von der Schule beurlauben lassen. Vom Morgengrauen bis zum Dunkelwerden hatte ich auf der Weide zu bleiben. Von Müdigkeit überwältigt, schlief ich manchmal ein. Wurde ich dabei erwischt, setzte es eine Tracht Prügel. Als Lohn sollte ich freies Essen und im Herbst einen Anzug für den Winter bekommen. Im Herbst erklärte jedoch der Bauer, dass er mir keinen Anzug geben könne, die Kühe hätten zu viel Schaden angerichtet, während ich schlief. So wurde ich schon als Kind um den Lohn betrogen.
Als der Winter kam, ging ich wieder zur Schule, die natürlich einklassig war. In Masuren wurde polnisch gesprochen, doch in der Schule war das bei Strafe verboten. Verließ der Lehrer das Klassenzimmer, um sein Vieh zu füttern, dann musste der älteste Schüler aufpassen, dass keiner polnisch sprch. Ließ dann doch jemand ein polnisches Wort verlauten, dann wurde vor seinen Platz ein Brett gestellt. Dieses Brett konnte er einem anderen Klassenkameraden zustecken, sobald er ihn beim Polnischsprechen erwischte. Kam der Lehrer wieder, dann erhielt der Prügel, bei dem das Brett stand. Auf diese Weise sollte die polnische Sprache ausgerottet und die deutsche eingeführt werden. Die Hälfte der Schulzeit war mit Religionsunterricht ausgefüllt. Ich war ein fleissiger Schüler, aber ich konnte nicht verstehen, warum Gott so große Unterschiede unter seinen Kindern duldete. Während ich – wie viele Schulkameraden – sehr schlecht gekleidet und frierend in Holzklumpen zur Schule gehen musste, obwohl die ganze Familie arbeitete, kamen die Kinder der Großbauern in warmen Schafspelzen und Lederstiefeln. Ich bekam trockenes Brot mit, und war auch dieses nicht da, kochte die Mutter Erbsen, bis sie trocken waren, und wir füllten uns damit die Taschen. Die Kinder der Großbauern aßen Weißbrot und Eier. Als ich meine Mutter wegen der Unterschiede um Rat fragte, antwortete sie, dass nur die Armen in den Himmel kämen und so später für ihre Leiden belohnt würden. Ich hätte aber gerne schon als Kind Weißbrot und bessere Stiefel gehabt, nicht erst im Himmel. Doch was die Mutter sagte, musste wohl richtig sein.
Ein großes Ereignis aus dieser Zeit ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Eines Tages mussten alle Männer des Dorfes in die Schule kommen. Um einen großen Kasten herum saßen der Gutsinspektor, der Lehrer und einige Großbauern. Jeder, der kam, erhielt einen Zettel und steckte ihn dann in den Kasten. Später erfuhr ich, dass das eine Reichstagswahl war. Noch am Abend desselben Tages ging eine Schreckenskunde durch das Dorf: Einer habe einen Stimmzettel für die Sozialdemokraten abgegeben ! Ich war neugierig, zu erfahren, was das ist, ein Sozialdemokrat. Ein Großbauer sagte: „Das ist ein Mensch, der sofort aus dem Dorf gejagt werden muss, ein Verbrecher, der das ganze Dorf ins Unglück stürzen will.“ Als ich meine Mutter befragte, ob das wahr sei, sagte sie: „ Ja, der Sozialdemokrat glaubt nicht an Gott, er will den König, der von Gott eingesetzt ist, töten. Daher ist es schon eine Sünde, einen Sozialdemokraten auch nur anzusehen.“ Am anderen Morgen wusste schon das ganze Dorf, dass der Sozialdemokrat der Schuster Freiß war, der den Bauern die Stiefel flickte und für die armen Leute im Winter die Holzklumpen anfertigte, auch so manchem, der sie nicht bezahlen konnte. Man ließ seine Sachen aus der Hütte tragen, ihm blieb nichts anderes übrig, als sich mit seiner Frau auf und davon zu machen. Mir gefiel das nicht. Ich konnte nicht begreifen, dass ein Mensch einfach fortgejagt wurde, nur weil er einen Zettel abgegeben hatte.
Aber auch wir mussten eines Tages unsere Lehmhütte verlassen. Ein Großbauer kam und erklärte, dass der Boden, auf dem unsere Hütte stand, ihm gehöre. Beim Kauf hatte mein Vater irgendwelche juristische Formalitäten aus Unkenntnis nicht beachtet. Der Gerichtsvollzieher kam und setzte unsere Familie – es war an einem Herbsttage 1896 – auf die Straße.
Wir wanderten aus nach Westfalen, in das Land de Sehnsucht aller Arbeiter von Masuren. Man erzählte sich, dort sei jeder ein freier Mensch, dort gäbe es keine Gutsbesitzer und keine Großbauern.
Als wir im Herbst 1896 in Westfalen ankamen, mietete mein Vater nahe der Zeche Königsgrube in Röhlinghausen, wo fast nur Bergarbeiter wohnten, eine Vierzimmerwohnung und richtete sie mit auf Abzahlung gekauften Betten ein, um Kostgänger zu halten. Das Kostgängerhalten war in diesen Gebieten eine zusätzliche Einnahmequelle, weil der Grubenlohn nicht zum Leben reichte. Und die Kostgänger waren zugewanderte Zechenarbeiter aus Ost- und Westpreußen und Posen, die ohne Wohnung waren und in Kost gingen. Unter diesen Umständen war ich nicht nur „Dienstmädchen“ für die Kostgänger, auch jede noch freie Zeit wurde ausgefüllt mit Kohlenlesen. Statt bei Spiel und Sport, verbrachten wir Kinder diese Zeit auf den Steinhalden nahe der Grube, um die zwischen den Steinen liegenden Kohlenstückchen herauszulesen und damit den Kohlenvorrat für den Winter zu sichern. Wurde wir dabei erwischt, dann mussten die Eltern Strafe zahlen, die höher war als der Preis einer ganzen Tonne Kohle. Der Traum vom schönen Westfalen, von dem die Arbeiter uns so oft erzählt hatten, verflog sehr schnell. Ich verglich unser Leben in Ostpreußen und jetzt in Westfalen und fand den Unterschied nur darin, dass dort die Großbauern und Gutsbesitzer alles hatten und bestimmten und hier die Zechenbesitzer und Zechendirektoren.
Als ich sechzehn Jahre alt war, fing ich auch auf der Grube an. Nach einigen Monaten aber kündigte ich, um auf eine andere Grube zu gehen, weil ich dort als Untertagearbeiter zwei Groschen pro Tag mehr verdient hätte. Doch der Betriebsführer eröffnete meinem Vater, dass auch ihm dann gekündigt würde und dass er die Zechenwohnung räumen müsse. Mein Vater war weit über fünfzig Jahre alt, und Arbeiter in diesem Alter wurden auf keiner Grube neu eingestellt. Dier Druck genügte, ich musste weiter für zwei Groschen weniger arbeiten. Das alles veranlasste mich, immer mehr über unsere Lage nachzudenken.
In späteren Jahren las ich in einem Parlamentsprotokoll, dass die Behauptung, die Bergarbeiter seien vor Streik 1905 schlecht behandelt worden, nicht den Tatsachen entsprochen hätte. So unglaublich das klingen mag, dass Arbeiter im 20.Jahrhundert bei der Arbeit geschlagen wurden, so war es doch eine Tatsache. Als ich 1901 auf der Königsgrube bei Kohlenverladung arbeitete, sah ich, dass der Aufseher bei der Morgen- und Mittagsschicht mit einem Gummischlauch bewaffnet war. Wenn die Jungen auf der Lesebank nicht schnelle genug die Steine herunterwarfen oder der Wagen mal überlief, weil ein neuer nicht schnell genug vorgeschoben wurde, dann stürzte er sich auf sie mit seinem Gummischlauch. Dabei kam es oft zu einem Handgemenge, wobei die Jungen, die ja in der Überzahl waren, ihm den Gummischlauch abnahmen und in Stücke rissen. Wurde aber einer von allein erwischt, dann ging es ihm dreckig.
Mehrmals sah ich, wie der Obersteiger und manchmal auch der Betriebsdirektor die Brotpakete der Bergleute, die noch in den Taschen der aufgehängten Jacken steckten, auswickelten. Der Titel der Zeitungen, in die das Brot eingewickelt war, interessierte sie. Ein Kumpel erzählte mir, dass Arbeiter, deren Brot in der „Bergarbeiter-Zeitung“ oder dem „Volksblatt“ eingewickelt gefunden würde, damit als Sozialdemokraten identifiziert, auf die schwarze Liste gesetzt und entlassen würden. Wer aber einmal auf der schwarzen Liste stand, bekam auf keiner Zeche mehr Arbeit.
Anfang 1905 erzählten sich die Bergleute, dass auf der Grube Bruchstrasse bei Dortmund gestreikt würde. Wir Schlepper berieten auf dem Wege zum und vom Schacht, ob wir nicht wie andere Zechen ebenfalls für Erhöhung des Schichtlohns streiken sollten. Um das allen Schleppern, Bremsern und Hauern mitzuteilen, malten wir mit Kreide an die Förderwagen : „Morgen Streik oder 3,80 Mark Schichtlohn.“ Wir erhofften auf der Königsgrube vom Streik auch die Beseitigung der Strafen, die den ohnehin erbärmlichen Lohn noch verminderten. Am nächsten Morgen aber zögerten die Hauer noch. Da legten wir Jungen einen Stempel (Verzimmerungsbalken) so in den Pferdewagen, dass sich der Balken in der Stapelzimmerung verfing und einige Seitenstützen herausriss. Als die Hauer sich aufregten, erklärten wir ihnen: Sorgt dafür, dass wir 3,80 Mark Schichtlohnbekommen, dass wird alles besser funktionieren, und ihr bekommt mehr leere Wagen.
Am folgenden Tage streikten im Revier schon sechsundsechzig Zechen. An diesem Morgen ging es auch bei uns los. In die Waschkaue kam der Betriebsführer mit einer Reihe von Beamten, und der Steiger forderte die Bergarbeiter auf, einzufahren. Als schon ein größerer Trupp am Schacht war, erscholl auf einmal eine Stimme, keiner wusste so recht, woher sie kam: „Kameraden, der Zechenverband hat die Forderungen der Bergarbeiter abgelehnt. Deshalb ist für das ganze Revier der Streik beschlossen. Keiner darf heute einfahren!“ – „Streik! Nicht einfahren!“ schrien die Schlepper wie aus einem Munde, und wir rissen die Alten und Wankelmütigen mit.
In unserem Bergarbeiterdorf Röhlinghausen herrschte reges Leben. Auf den Straßen und in den Zechenkolonien standen die streikenden Bergarbeiter. Ein großes Polizeiaufgebot aus Köln, Berlin und anderen Großstädten, zu Fuß und zu Pferde, hielt Straßen und Plätze besetzt. Die Zechenbeamten waren ebenfalls mit Revolvern bewaffnet und durch eine Armbinde als Hilfspolizei gekennzeichnet. Wer nicht zur Arbeit gehen wollte, wurde mit Hinauswurf aus der Wohnung bedroht. Wir jungen Burschen amüsierten uns über die Zechenbeamten, die in Grube vom Betriebsführer Ohrfeigen erhielten und jetzt mit Revolvern umherliefen und Streikbrecher suchten.
Schon am ersten Streiktage, am 17. Januar 1905, fand die erste Streikversammlung unserer Grube statt. Die Belegschaft, die 1700 Bergarbeiter zählte, war fast vollständig erschienen. Es war meine erste Versammlung. Sie wurde von einem älteren Bergarbeiter, der nicht zu unserer Grube gehörte, eröffnet; denn die Königsgrube war die reaktionärste Zeche, und es hatte sich aus Furcht vor Maßregelung niemand für die Leitung gefunden. Der Redner teilte mit, dass fast das ganze Ruhrgebiet im Streik stände. Von 280 000 Bergarbeitern seien kaum 10 Prozent am arbeiten, die Königsgrube sei die letzte. Die vier Bergarbeiterverbände hätten sich geeinigt, eine gemeinsame Streikleitung gebildet, genannt Siebenerkommission, die mit dem Verein der Zechenbesitzer über die Forderungen der Streikenden verhandele. Gerade die Königsgrube habe im letzten Jahr 43 Prozent Dividende ausgezahlt; die fünf Aktionäre hätten im letzten Jahr drei Millionen Mark verdient. Der Streik ginge um Durchsetzung einer Lohnerhöhung, Beseitigung der Überschichten und des Strafsystems, gegen das Wagennullen, für geregelte Ein- und Ausfahrt. – Die Belegschaftsversammlung machte einen großen Eindruck auf mich.
Die Ursachen Streiks von 1905 lagen in der Hauptsache in den Versuchen der Grubenverwaltungen, die Arbeitszeit über die für Bergarbeiter gesetzlich festgelegten acht Stunden hinaus zu verlängern. Das war dadurch möglich, dass die Seilfahrtzeiten, deren Dauer gesetzlich nicht festgesetzt war, verlängert wurden. Zum Beispiel: War die Arbeitszeit von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags festgesetzt, so mussten die letzten Arbeiter um 6 Uhr morgens in der Grube sein, und der erste musste um 2 Uhr herausfahren. Waren zur Seilfahrt 30 Minuten notwendig, so fand die Seilfahrt also von 5.30 bis 6 Uhr und mittags von 2 bis 2.30 Uhr statt. Viele Grubenverwaltungen erklärten nun einfach, dass diese Zeit nicht ausreiche und setzten durch die Arbeitsordnung die Seilfahrtzeiten von 5.15 bis 6 Uhr und von 2 bis 2.45 Uhr fest. Es wurde also um 5.15 Uhr mit der Einfahrt begonnen, und wenn kein Mann mehr am Schacht war, dann wurde Seilfahrt beendet und mit der Kohleförderung begonnen. Wer zu spät kam, ganz gleich ob es schon 6 Uhr war oder noch nicht, musste wieder nach Hause gehen. Des Mittags wurde dann auch nicht um 2 Uhr, sondern erst um 2.15 Uhr oder 2.20 Uhr mit der Ausfahrt begonnen. Auf diese Weise wurde die Anwesenheit in der Grube bis zu einer halben Stunde oder noch mehr verlängert.
Ein anderer Grund war das Wagennullen. Die Arbeitsordnung sah vor, dass Wagen, die nicht genügend beladen waren, den Hauern nicht bezahlt wurden, ebenso, wenn zu viele Steine zwischen den Kohlen waren. Mit der Überwachung war ein Zechenbeamter betraut, der gewöhnlich die Aufsicht am Schacht und in der Verladung hatte. In seinem „Pflichteifer“ musste der kleine Aufseher, ob er wollte oder nicht, von jeder Schicht acht, zehn oder noch mehr Prozent der Wagen, die aus der Grube kamen, mit „ungenügend beladen“ oder „zu viel Steine“ kennzeichnen. Das nannte man Nullen. Die Hauer erhielten diese Wagen nicht bezahlt. Da der Aufseher nicht nur das Nullen zu besorgen hatte, sondern viele andere Arbeiten, erledigte er das Nullen einfach dadurch, dass er wahllos die „notwendige“ Menge Wagennummern wegnahm. So kam es vor, dass Wagen von Kameradschaften (jede Kameradschaft hatte eine besondere Nummer) als unrein genullt wurden aus solchen Flözen, wo die Kohle vollkommen rein war. Diese Art des Nullens war reiner Diebstahl und wurde von den Bergarbeitern auch als solcher angesehen. Neben diesen beiden Fragen waren natürlich auch die Lohnfrage – die Bergarbeiter forderten 15 Prozent Lohnerhöhung -, die Behandlung der Bergarbeiter usw. von Bedeutung.
Die Verlängerung der Seilfahrtzeit war der eigentliche Anlass zum Streik. Am 5. Dezember 1904 war auf der Zeche Bruchstrasse die Belegschaft in den Streik getreten. Das war das Signal für das ganze Revier. Einige Tage später wurde auf der Grube „Herkules“ ein Funktionär des alten Verbandes – so wurde der freigewerkschaftliche Verband der Bergarbeiter Deutschlands genannt, der 1890 gegründet wurde – gemaßregelt, worauf die Belegschaft ebenfalls in den Streik trat. In den ersten Januartagen schlossen sich weitere Gruben dem Streik an. Am 8. Januar standen bereits über 12 000 Bergarbeiter im Kampf. An diesem Tage traten die Vorstände der vier Bergarbeiterverbände zusammen, um die Lage zu beraten. Das Ergebnis dieser Beratung war ein Aufruf an die Bergarbeiter mit der Aufforderung zu Ruhe und Ordnung. Die Bergarbeiter wurden ersucht, nichts ohne die Zustimmung der Verbandsvorstände zu unternehmen. Der Aufruf kam aber schon zu spät. In den nächsten Tagen traten weitere Gruben in den Streik. Am 12. Januar 1905 streikten bereits über 60 000 Bergarbeiter. Jetzt versuchten die Verbandsvorstände auf einer großen Revierkonferenz am 12. Januar in Essen, an der über 150 Vertrauensleute aller vier Verbände teilnahmen, die Ausdehnung des Streiks zu verhindern. Unter der Vorspiegelung, dass der Verein der Zechenbesitzer verhandeln werde, und besonders dadurch, dass die Führer des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter erklärten, sie würden sich am Streik nicht beteiligen, gelang es ihnen auch, die Proklamierung des Generalstreiks der Bergarbeiter zu hintertreiben. Die Erklärung der Christlichen gab auch den Führern des alten Verbandes, Hue und Sachse, den Vorwand zum Bremsen.
Von dieser Konferenz aus wurden die Forderungen der Bergarbeiter dem Verein für die bergbaulichen Interessen (kurz Zechenverband) unterbreitet und die Siebenerkommission gewählt. Dieser gehörten an: vom alten Verband Sachse und Hansmann, vom christlichen Gewerkverein Effert und Kühme, Hammacher von den Hirsch-Dunckerschen und Regulski und Brzeskot von der polnischen Berufsvereinigung. Die Siebenerkommission sollte die Verhandlungen mit dem Verein der Zechenbesitzer führen und am 16.januar einer neuen Konferenz Bericht erstatten.
Der Zechenverband lehnte die Forderungen natürlich ab. Er würdigte die Siebenerkommission so, dass er ihr noch nicht einmal eine Antwort auf ihr Schreiben erteilte, sondern die Antwort nur in der Presse veröffentlichen ließ. Mittlerweile breitete sich der Streik weiter aus. Als am 16. Januar die neue Revierkonferenz zusammentrat, standen schon 120 000 Bergarbeiter im Streik.
Der Siebenerkommission blieb nichts anderes übrig, als den Generalstreik aller Bergarbeiter zu proklamieren. Auch die Führer des christlichen Gewerkvereins waren jetzt zum Streik gezwungen, weil die christlichen Arbeiter bereits Seite an Seite mit den anderen Arbeitern im Streik standen.
Die Einzelheiten des Streiks, die Zusammenstöße mit Polizei, Gendarmerie usw. zu schildern, ist hier nicht der Platz. Nur eins möchte ich bemerken, dass in diesem Streik im Essener Revier aus den Reihen der organisierten Streikenden sogenannte Streikordner aufgestellt wurden. Diese erhielten von dem Oberbürgermeister der Stadt Essen, der ja auch gleichzeitig Polizeioberhaupt war, die Rechte von Hilfspolizisten. Da im Industriegebiet fast alle Städte und Dörfer Kommunalpolizei hatten, forderten wir überall solche Ordner als Hilfspolizisten aus den Reihen der organisierten Bergarbeiter. Der Essener Oberbürgermeister musste jedoch unter dem Druck der Grubenherren und der Regierung seine Verordnung zurücknehmen, und Kölner und Berliner Polizei zog auch in Essen ein. Die von den Zechenherren mit Revolvern bewaffneten Zechenbeamten wurde jedoch als Hilfspolizisten anerkannt.
Da jetzt auf den Gruben im Gegensatz zu 1889 überall Kader von organisierten Bergarbeitern vorhanden waren, wurde der Streik, wenn auch gegen den Willen der Organisationsleitungen, doch organisiert begonnen. Im Kernrevier standen die Belegschaften vollkommen oder mit weit über neunzig Prozent im Streik. Auf der Grube, wo ich beschäftigt war, ist von 1 600 Mann Untertagebelegschaft die Zahl der Streikbrecher vom Beginn des Streiks an bis zum 9. oder 10. Februar nie über sechzig hinausgegangen, also nicht einmal vier Prozent.
Obwohl der Streik so geschlossen geführt wurde, blieben die Grubenherren fest bei ihrem Standpunkt, dass der Streik „nicht durch Verhandlungen, sondern durch eine Kraftprobe“ entschieden werden müsste. Die Streikführung, vor diese Tatsache gestellt, wusste keinen anderen Ausweg als den Abbruch des Kampfes.
Der Abbruch wurde ihr durch eine Regierungserklärung erleichtert. Als die Grubenherren auch die Vermittlungsversuche der Regierung kategorisch ablehnten, veröffentlichte diese eine Erklärung, in der den Bergarbeitern versprochen wurde: Gesetzliche Regelung der Arbeitszeit und der Seilfahrt, gesetzliches Verbot der Überschichten, obligatorische Einführung der Arbeiterausschüsse, gesetzliches Verbot des Nullens, Begrenzung der Strafen. Doch die späteren Verhandlungen im Preußischen Landtag um die Änderung des Berggesetzes zeigten, dass die Grubenherren stärker waren als die Regierung.
Auf einer Revierkonferenz des Bergarbeiterverbandes am 2. Februar wurden die Funktionäre schon auf einen Abbruch des Streiks vorbereitet. Besonders wurde die finanzielle Lage und die Armut der Bergarbeiter in den Vordergrund geschoben, die den Bergarbeitern einen langen Streik nicht erlaube. Otto Hue erklärte, wenn in acht Tagen keine Änderung eintrete, müsse der Streik beendet werden.
Am 9.Februar wurde dann auch auf der von der Siebenerkommission nach Essen einberufenen Konferenz vorgeschlagen, den Streik abzubrechen. Der Beschluss stieß auf starken Widerstand selbst bei den Funktionären der Bergarbeiterorganisationen. Der Streik wurde dann auch erst allmählich eingestellt. Die ersten Belegschaftsversammlungen fassten in vielen Fällen Beschlüsse zum Weiterstreiken. Erst am 16. Februar konnte der Streik als beendet betrachtet werden.
War der Streik ein Erfolg oder eine Niederlage der Bergarbeiter ? Diese Frage wurde lange unter den Bergarbeitern diskutiert. Wir Jungen waren noch nach dem Streik ausgesperrt. Ich erhielt erst nach vier Wochen wieder Arbeit. Wir mussten für unsere „Dummheiten“ einen Denkzettel bekommen, sagte uns der Obersteiger. Aber wir empfanden das keineswegs als eine Niederlage. Im Gegenteil, wir freuten uns, dass wir es den Herren einmal gezeigt hatten, dass sie nicht alles mit uns machen konnten, was sie wollten. Etwa zwei Wochen nach Wiederaufnahme der Arbeit erhielten wir auch zwanzig Pfennige Zulage zum Schichtlohn; der Steiger sagte zwar, dass wir die zwanzig Pfennige auch ohne Streik erhalten hätten.
Im Bergarbeiterverband wurde der Streik ebenfalls lange diskutiert. Die Siebenerkommission sagte in ihrem Aufruf zum Streikabbruch, dass der Streik den Bergarbeitern einen Erfolg gebracht hätte. Die Regierung hätte die Berechtigung der Bergarbeiterforderungen anerkannt, nun würde gesetzlich das festgelegt werden, was die Grubenherren nicht freiwillig geben wollten. Sachse und Hue erklärten, dass es nicht darauf ankäme, ob die Grubenherren die Forderungen bewilligen oder nicht, sondern der Erfolg läge darin, dass die Regierung gezwungen wurde, nun ernstlich die gesetzliche Regelung der wichtigsten Fragen vorzunehmen. Die Versprechungen, die die preußische Regierung am 27. Januar 1905 den streikenden Bergarbeitern hatte machen müssen, wurden dann im Landtag mit Hilfe des Zentrums unter den Tisch gebracht. Innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wurde der Bergarbeiterstreik Ausgangspunkt zu der Diskussion über die Bedeutung des proletarischen Massenstreiks.
Norbert Kozicki, mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung Dietz Verlag Berlin