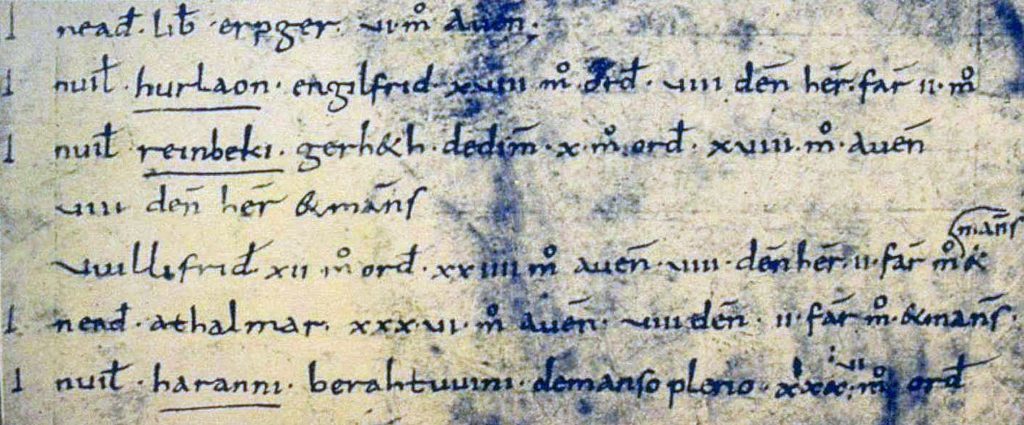Die Novemberrevolution 1918 und die Lebenssituation der Bergarbeiter und ihrer Familien in der Gemeinde Röhlinghausen
Die Novemberrevolution brachte für die konkrete Situation der Bergarbeiter im Ruhrgebiet die Einführung der Achtstundenschicht einschließlich Ein- und Ausfahrt, was im ersten Abkommen vom 14. November 1918 von Bergarbeitergewerkschaften und Zechenverband vereinbart wurde. Bisher hatte die Arbeitszeit auf den Ruhrzechen unter Tage acht Stunden ausschließlich Ein- und Ausfahrt betragen. Angesichts der Tatsache, dass inzwischen eine Revolution stattgefunden hatte, war eine Verkürzung der Arbeitszeit um durchschnittlich eine halbe Stunde nicht gerade beträchtlich – ganz abgesehen davon, dass die Revolution bedeutendere Ziele, voran die Sozialisierung de Betriebe, auf die Tagesordnung gesetzt hatte. In dem oben erwähnten Abkommen wurde weiter vereinbart, dass künftig alle Streitpunkte nur noch durch Verhandlungen beigelegt werden sollten. Damit setzten die Gewerkschaften ihren im Krieg geleisteten Streikverzicht fort.
Am 23. November 1918 gestand der Zechenverband den Gewerkschaften geringfügige Lohnerhöhungen zu, in der Hoffnung, damit die Bergarbeiter beruhigen zu können. Das erwies sich als Fehlschlag. Die Bergarbeiter, die während des Ersten Weltkriegs unter der Lohndrückerei und der sehr schlechten Lebensmittelsituation (‚Steckrübenwinter 1916/17‘) gelitten hatten, forderten weit größere Zugeständnisse von den Bergbauunternehmern, um wieder zu einigermaßen verträglichen Lebensverhältnissen zu kommen.
Dazu muss man wissen, dass sich die wirtschaftliche Situation der Bergbaugesellschaften während des Krieges enorm verbessert hatte. Die Magdeburger Gesellschaft der Zeche Königsgrube in Röhlinghausen war in der Lage, auf neue Aktien 28 Prozent Dividende auszuschütten. Das war keine Einzelfall. Andere Zechengesellschaften schütteten Dividenden in Höhe von 20 bis 25 Prozent aus. Der wirtschaftliche Spielraum für angemessene Lohnerhöhungen war für die extrem gefährliche Tätigkeit unter Tage jederzeit gegeben. Man sollte auch wissen, dass fast jedes Jahr seit 1911 ca. 2.000 Bergarbeiter ihr Leben unter Tage verloren, und zwar in der Regel nicht bei Massenunfällen wie Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionen, was die Statistik der Knappschaft belegt, sondern bei Unfällen unter Tage.
Im Dezember 1918 beteiligten sich im Raum von Wanne und Eickel die Kumpel von der schon erwähnten Zeche Königsgrube an der Streikbewegung im Ruhrgebiet. Der Grund dafür war die besonders katastrophal schlechte Lebenssituation der Bergarbeiter und ihrer Familien in der Gemeinde Röhlinghausen. Diese Dezemberstreiks waren in der Hauptsache eine Bewegung für die Verbesserung der materiellen Lebenssituation. Die betriebliche Situation der Bergarbeiter war auch nach der Novemberrevolution „…noch am ehesten den Herrschaftsstrukturen in Arbeitslagern für Strafgefangene vergleichbar..“, stellt der Historiker Eckhard Brockhaus fest. (Eckhard Brockhaus: Zusammensetzung und Neustrukturierung der Arbeiterklasse vor dem Ersten Weltkrieg, München, 1975, S. 94).
So kündigten sich schon im November unter den Bergleuten Streikbewegungen an, die sich besonders auf Forderungen konzentrierten: Verbesserungen der finanziellen Lage durch Lohnerhöhungen und finanzielle Sonderzuwendungen, Veränderungen der Arbeitsbedingungen durch eine spürbare Verkürzung der Arbeitszeit, Veränderung der Wirtschaftsordnung und damit auch der Betriebsverfassung durch eine Sozialisierung des Bergbaus, was von den meisten Bergarbeitern als sozialistisch eingeschätzt wurde. Angesichts der Streikbereitschaft der Bergleute versuchten die Arbeiter- und Soldatenräte des Landkreises Gelsenkirchen (die Ämter Wanne und Eickel gehörten zum Landkreis), die am 3. Dezember 1918 in Eickel tagten, mäßigend auf die Bergarbeiter einzuwirken. Sie forderten mehrheitlich die Bergarbeiter auf, „im Interesse der sozialistischen Republik, zur Arbeit zu gehen.“
Bevor die Streikereignisse auf der Zeche Königsgrube geschildert werden, gibt es hier einen kurze Darstellung der Lebenssituation der Bergarbeiter und ihrer Familien in der Gemeinde Röhlinghausen. Dabei wird deutlich, welche äußerst repressive Rolle der Zechendirektor Daniel Bonacker von der Zeche Königsgrube dabei spielte.
Die soziale und kulturelle Infrastruktur der Gemeinde Röhlinghausen wurde entscheidend durch die Interessen der Zechengesellschaft der Zeche Königsgrube geprägt. Noch am 10. September 1918 stellte das sozialdemokratische Bochumer Volksblatt fest, dass das Dreiklassenwahlrecht auch formal den starken Einfluss der Unternehmer auf die Politik der Gemeinde garantierte. Die SPD-Mitglieder, die in jenen Tagen das Bochumer Volksblatt oder die Bergarbeiterzeitung vom sozialdemokratisch ausgerichteten Alten Verband bezogen, erhielten die Zeitung nicht nach Hause zugestellt, sondern mussten sie unauffällig bei einem Röhlinghauser Friseur abholen. Sozialdemokraten wurden auf der Zeche Königsgrube nicht geduldet und verloren bei Bekanntwerden der Parteimitgliedschaft ihren Arbeitsplatz und die Werkswohnung in der Kolonie. Aus diesem Grund kontrollierten häufig die Grubenbeamten auf Veranlassung des Zechendirektors Bonacker die mitgebrachten Brote, um zu prüfen, in welchen Zeitungen die Lebensmittel eingepackt waren.
Die Finanzen der Gemeinde Röhlinghausen wurden im Interesse der alles beherrschenden Zechengesellschaft eingesetzt. Für soziale Einrichtungen stand nur wenig Geld zur Verfügung. Das Bochumer Volksblatt berichtete im September 1918, dass konkrete Kritik auf einer Bürgerversammlung angesichts von Plänen einer Eingemeindung geäußert wurde. So wurden die Säuglingsfürsorge und die Jugendpflege in Röhlinghausen nicht angeboten. Die Altenfürsorge wurde ebenso vernachlässigt. In der Gemeinde gab es zum damaligen Zeitpunkt kein Seniorenheim. Zur Konsultation eines Arztes mussten die Betroffenen auf andere Gemeinden ausweichen, da seit vier Jahren für die 15.000 Einwohner kein Arzt mehr zur Verfügung stand. Der schlechte und unzureichende Zustand des öffentlichen Nahverkehrs verschärfte diese Situation. Ein kleine Badeanstalt wie in vielen Gemeinden fehlte ebenso. Schließlich machten Bürger während der Versammlung darauf aufmerksam, dass in der Gemeinde auch Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten für die Arbeiter und ihrer Familien fehlten.
Die Rücksichtslosigkeit mit der die Zechendirektion gegenüber den Belegschaftsangehörigen vorging, zeigte sich besonders bei der Gestaltung der Mietverhältnisse in den Zechenkolonien. So wurde ein Bergmann der Zeche Königsgrube aufgefordert, seine beiden Söhne innerhalb von 48 Stunden aus der Wohnung zu verweisen, weil sie nicht auf der Zeche arbeiteten. Ihm wurde angedroht, dass er ansonsten die Wohnung zu räumen hätte. Nachdem er sich diesem Willkürakt mit dem Hinweis auf die geltenden Gesetze widersetzt hatte, wurde er zum Direktor Bonacker bestellt, der ihn mit einem Bußgeld von fünf Mark bestrafte und schließlich die Wohnung kündigte. (Bochumer Volksblatt vom 27. März 1918, Nr. 73)
In der Presse widersprach Daniel Bonacker der Darstellung des Bergmanns, nannte aber keine anderen Gründe für die Kündigung. Er musste zugeben, dass das Mieteinigungsamt die ausgesprochene sechswöchige Kündigungsfrist für unzulässig hielt und auf drei Monate verlängerte. (Bochumer Volksblatt vom 3.4.1918, Nr. 77)
Das auf den Zechen übliche und von den Bergleuten ganz besonders gefürchtete und verhasste Strafwesen wurde auch auf der Königsgrube häufig ausgeübt. Wer gegen die Arbeitsordnung verstieß, wurde mit Lohnabzug bestraft. Der Redakteur des Bochumer Volksblatt berichtete:
Auf Zeche Königsgrube wurde im Juli ein Bergmann mit 25 Mark und Streichung eines Schichtlohns von über 12 Mark bestraft, weil er sich an seinem Vorgesetzten vergriffen hatte. Das durfte der Arbeiter nicht tun, jedoch will er in Notwehr gehandelt haben. Ob hier der Beamte oder der Arbeiter den Streit verschuldet hat, entzieht sich unserer Beurteilung. Der Arbeiter durfte aber nach dem Berggesetz nicht mehr als mit einem Schichtlohn bestraft werden, während er in Wirklichkeit mit drei Schichtlöhnen bestraft wurde. Die Zeche verhängte hier eine Strafe von 37 Mark und vollstreckte sie durch Abhalten der Strafe vom Lohn, ohne dass der Arbeiter dagegen Widerspruch erheben noch seine Unschuld bzw. die Schuld des Beamten nachweisen kann. Es bleibt ihm nur der Weg zum Berggewerbegericht übrig und hier tritt dann sein vorheriger Kläger und Richter als Zeuge gegen ihn auf, trotzdem er Partei in derselben Sache ist. (19.9.1918, Nr. 220)
Die Ausklammerung der Frage des Strafwesens im Rahmen der Verhandlungen zwischen Zechenverband und Gewerkschaften war übrigens ein weiterer Grund, um die Streikbereitschaft der Bergleute im Dezember 1918 zu erhöhen. Die brutale Unterdrückung durch die Zechendirektion löste auch individuelle Handlungen der Gegenwehr aus: Jugendliche Bergarbeiter aus der Blücherstrasse haben unbefugter Weise den Ringofen der Zeche Königsgrube betreten und dort in jugendlichen Übermut eine Mauer umgeworfen. (Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung vom 2.9.1918, Nr. 205)
Die Streikbewegung auf den Zechen des Ruhrgebiets vom Dezember 1918 war vor allem eine Bewegung für wirtschaftliche Verbesserungen. Hans Mommsen konstatiert: ‚Die radikalen Ausstandsbewegungen, die sich vom Zentrum Hamborn aus im westlichen Ruhrgebiet ausbreiteten, entzündeten sich an konkreten Lohn- und Arbeitszeitfragen, wobei die nicht voll eindeutige Vereinbarung über die achtstündige Schichtzeit einschließlich Seilfahrten vom 18. November 1918 einen der auslösenden Faktoren darstellte. Für die Bewegung war charakteristisch, dass sie Verbesserungen der Lage der Bergleute, vor allem eine Verkürzung der Arbeitszeit, die Zahlung von Mindestlöhnen und Urlaubsgeld sowie die Zusicherung angemessener Deputatkohlenlieferungen anstrebte. (Hans Mommsen: Die Bergarbeiterbewegung an der Ruhr 1918-1933, in: Jürgen Reulecke (Hg.): Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr, Wuppertal 1974, S. 290)
So erhielt der Arbeiter- und Soldatenrat von Gelsenkirchen ein Telegramm des Demobilmachungsausschusses aus Berlin, in dem er …aufgrund verschiedener Vorkommnisse auf einzelnen Kohleschachtanlagen…, dringend ersucht wurde, auf die Bergleute einzuwirken, damit sie vorläufig von ihren Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung absähen. (Bochumer Zeitung vom 2.12.1918, Nr. 282)
Die Bergarbeiter waren während der Kriegsjahre einer besonders intensiven Auspressung der Arbeitskraft unterworfen, und nun doppelt enttäuscht, dass die politischen Umwälzungen keine nennenswerten Änderungen ihrer materiellen Situation mit sich brachten.
Die Belegschaft der Zeche Königsgrube stellte am 15. Dezember 1918 einen Forderungskatalog mit 25 einzelnen Punkten auf, in dem höhere Löhne, Zahlung von Teuerungszulagen und andere Zuschüsse, Lieferung von Hausbrandkohle, Verkürzung der Arbeitszeit, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Gleichstellung der Lokomotivführer und Handwerker über Tage mit den Hauern verlangt wurde. (Staatsarchiv, Oberbergamt Nr. 1793, Bl. 275/276) Weiterhin sollten mehrere gekündigte Steiger wieder eingestellt und der Steiger, dem die Kündigungen zu Last gelegt wurden, entlassen werden.
Besondere Beachtung fand der Punkt 25: ‚Entlassung des Direktors Bonacker. Zunächst hat diesen Antrag Roßdeutscher gestellt. Der Antrag ist damit begründet, dass die Beamten und Arbeiter unter einem derartigen Druck ständen, dass sie nicht wüssten, woran sie wären. Solange der Herr Direktor hier wäre, würde er sich nicht beugen, er glaube, er habe noch die große Macht wie früher und solange er hier wäre, würde es auf Königsgrube nicht anders.‘
Nur ein Punkt des umfangreichen Forderungskatalogs hatte konkreten politischen Charakter: ‚Abgabe der Verbandsbücher und Legitimationskarten bei den Steigern. Es soll kein Mann mehr eingestellt werden, der nicht organisiert ist. Der Soldatenrat von Hordel Scholz hat sich erboten, die Kontrolle darüber auszuüben, ob die Leute organisiert sind.‘ Diese ‚Zwangsorganisierung‘ entsprach einer Aufforderung des Gelsenkirchener Arbeiterrates vom November 1918, die in Form eines Aufrufs an verschiedenen Zechen verbreitet wurde. Auf der Zeche Königsgrube kam der besagte Aufruf nicht zum Aushang. Die Belegschaft entzog dem Arbeiterausschuss das Vertrauen und wählte einen neuen Arbeiterausschuss, der aus je einem Mitglied der vier Bergarbeitergewerkschaften bestand. Dieser Arbeiterausschuss brachte sofort den Aufruf zum Aushang. Diese Forderung der „Zwangsorganisierung“ wurde nicht nur auf der Zeche Königsgrube gestellt, sondern wurde auch von den Belegschaften der meisten Zechen im Ruhrgebiet gefordert. (Hans Spethmann: Zwölf Jahre Ruhrbergbau, Bd.1, S. 89 und S. 105 f)
Das Oberbergamt berichtete, dass am 16. und 17. Dezember 1918 über die 25 Forderungen der Belegschaft der Zeche Königsgrube verhandelt wurde. Die Verhandlungen moderierte der Wanner Soldatenrat. Zugeständnisse von Seiten der amtierenden Zechenverwaltung – Zechendirektor Bonacker war mittlerweile abgesetzt worden – wurden dabei nur in nebensächlichen Punkten gemacht, wie z.B. bessere Reinigung der verschmutzten Kaue. Die wesentlichen Forderungen nach höherem Lohn und verbesserten Arbeitsbedingungen wurden entweder strikt abgelehnt oder mit vagen Zusagen, die leicht wieder rückgängig gemacht werden konnten, beantwortet.
Die Absetzung des Zechendirektors bezeichnete seine Vertretung in der Zechenleitung als ‚völlig grundlos‘ und wies diese mit Empörung zurück. Die Kumpel der Zeche Königsgrube waren da anderer Meinung. Im Rahmen einer Belegschaftsversammlung stimmten 1.090 von 1.106 anwesenden Bergleuten für die Absetzung des selbstherrlichen Zechendirektors. Die praktische Leitung der Zeche Königsgrube übernahm ein neugewählter sogenannter Zechenrat. Das muss in der Gemeinde Röhlinghausen eine Sensation gewesen sein, dass der „große Zechenpatriarch“ Daniel Bonacker – seit 1894 Betriebsführer der Königsgrube – abgesetzt wurde. Daniel Bonacker wurde nach der Abstimmung der Belegschaft von den streikenden Kumpel sogar am Betreten des Zechengeländes gehindert. Nach seiner Absetzung verließ er für einige Wochen mit seiner Familie den Ortsteil Röhlinghausen. Die Sicherheitstruppe des Wanner Soldatenrates konnte nicht mehr für seine Sicherheit garantieren. In Anwesenheit des Reichskohlenkommissar Röhrig fanden die Verhandlungen zwischen der Belegschaft und der Bergwerksgesellschaft statt. Die Verhandlungen brachten zwar kein konkretes Ergebnis. Die Verhandlungen erbrachten vielfache Beweise dafür, in welcher unwürdigen Weise Bonacker Arbeiter und Angestellte behandelte und oft geringfügiger Dinge wegen zahlreiche Existenzen vernichtete, empörte sich der Redakteur des Bochumer Volksblattes.
Nachdem die Bergwerksgesellschaft die wesentlichen Forderungen der Belegschaft ablehnte, traten die Bergarbeiter in den Streik. Am 17. Dezember 1918 waren 1.290 Bergleute im Ausstand. Aufgrund einer zentralen Vereinbarung zwischen dem Zechenverband und den vier Bergarbeitergewerkschaften sollte der Lohn ab dem 1. Januar 1919 um 15 Prozent erhöht werden. Eine einmalige Weihnachtszulage wurde von den Unternehmen abgelehnt. Das wichtigste Ergebnis dieser Vereinbarungen war: Die Lohnerhöhung würde unter der Bedingung gewährt, dass auch die Kohlenpreise erhöht werden, da bei den jetzigen Kohlenpreisen die Löhne nicht bestritten werden können. (Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung vom 16.12.1918, Nr. 294) Für die Ereignisse auf der Zeche Königsgrube hat diese Vereinbarung eine besondere Bedeutung. Dazu die Antwort der Zechenverwaltung auf die Lohnforderungen der Königsgruber Kumpel, die ursprünglich 25 Prozent Lohnerhöhungen gefordert hatten. Laut den den Akten des Oberbergamtes im Staatsarchiv teilte die Zechenleitung der Belegschaft mit: ‚Die Forderung muss bei den jetzigen Kohlenpreisen abgelehnt werden. Im übrigen muss die Zeche bezüglich Lohnforderungen sich an den Abmachungen halten, die zwischen dem Zechenverband und den vier Arbeitervertretern herbeigeführt sind.‘ (STAM, OBA, Nr. 1793, Bl. 277)
Die Äußerung des zentralen Zechenverbandes, dass die Lohnerhöhungen nur unter der Bedingung gewährt werden können, wenn die Kohlenpreise steigen, weil daraus die Löhne bestritten werden, deckt sich nicht mit den wirtschaftlichen Tatsachen. Oben wurde bereits erwähnt, dass z. B. die Zechengesellschaft der Königsgrube in der Lage war, bis zu 28 Prozent – einige andere Forscher sprechen von bis zu 30 Prozent – Dividende zu zahlen. Dazu gesellten sich noch enorme Abschreibungen. Während des Ersten Weltkriegs waren die Löhne weit hinter den Kohlenpreisen zurückgeblieben, während die Gewinne von den 14 größten Montanfirmen einschließlich der Bergwerke im Ruhrgebiet um fast 70 Prozent in die Höhe schnellten. (Heinrich Teuber: Für die Sozialisierung des Ruhrbergbaus, Frankfurt a.M, 1973, S. 30)
In einer Debatte des Preußischen Landtags vom 9. Dezember 1921 sprach der Abgeordnete Gustav Sobottka aus dem Amt Eickel (KPD) zum Thema des Haushalts der Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung von Preußen. Er ging in seiner Rede auf das Verhältnis von Kohlenpreis und Arbeiterlöhnen ein. Er führte aus: ‚Wenn nun von verschiedenen Seiten immer wieder darauf hingewiesen wird, wie es ganz besonders von der rechten Seite des Hauses geschieht, dass gerade die hohen Arbeiterlöhne die Kohlenpreise so verteuern, möchte ich hier den Bericht der Bergwerksdirektion Recklinghausen anführen, aus dem hervorgeht, dass im Jahre 1918 die ordentliche Einnahme für die Tonne Kohlen 38,60 Mark betrug, und davon entfielen auf Lohn 19,60 Mark, das sind 51%. Im Jahre 1919 wurden für die Tonnen Kohlen 102,47 Mark vereinnahmt, an Arbeiterlöhnen wurden für die Tonne 49,95 Mark bezahlt, das sind nur 48%.“ (Protokoll des Preußischen Landtags, 80.Sitzung am 9.Dezember 1921, S. 5578)
Der Eickeler Abgeordnete Gustav Sobottka von der Füsilierstrasse (heutige Martinistrasse) machte auf den prozentualen Anteil des Lohnes auf den Kohlenpreis aufmerksam. Interessanter ist aber, dass die Brutto-Gewinnspanne beim Verkauf der Kohle von rund 19 Mark auf rund 52 Mark innerhalb eines Jahres stieg. Die Argumentation war: ‚Die Kohlenpreise müssen erhöht werden, um die höheren Löhne zu bezahlen.‘ Die ökonomischen Daten aus unterschiedlichen Quellen verdeutlichen, dass hier eine tarifpolitische Lüge feststellbar ist.
Nach den Dezemberstreiks im Ruhrbergbau erfuhren die alten Bergarbeitergewerkschaften einen kräftigen Rückgang ihrer Mitgliederzahlen. Diese Organisationen hatten sich mit der Bildung der Tarifgemeinschaft verpflichtet, Streitigkeiten nur auf dem Verhandlungsweg zu bereinigen. Man verzichtete praktisch auf das Streikrecht. Die große Mehrheit der Bergarbeiter sollten dieser gewerkschaftspolitischen Ausrichtung im ersten Halbjahr des Jahres 1919 nicht mehr folgen. Im Januar 1919 begann die Bewegung für die Sozialisierung des Ruhrbergbaus. Die Parole ‚Streik ist heute Verrat an der Revolution‘ der traditionellen Gewerkschaften hatte im Frühjahr 1919 kaum noch eine Wirkung.
Norbert Kozicki