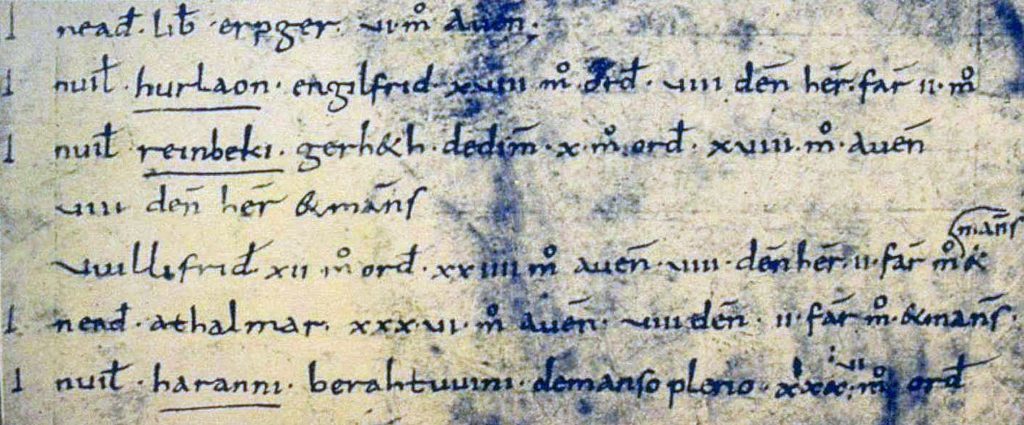Die schulpflichtigen jüdischen Kinder hatten bis zur Gründung einer eigenen Schule einen sehr mühsamen Schulalltag. Im Sommer mussten sie täglich nach Bochum, um dort die jüdische Schule zu besuchen. Im Winter, wenn die Witterung den Weg nach Bochum nicht zuließ, wurden die evangelischen Schulen in Eickel oder Herne besucht. Diese Situation führte dazu, dass besonders die ‚Vorkenntnisse in den hebräischen Fächern‘ um 1862 kritisiert wurden, wenn sich hiesige Juden auf weiterführenden Schulen bewarben.
Für die jüdischen Schulkinder in Herne besserte sich die Situation 1889, als eine jüdische Privatschule gegründet wurde. Zehn Jahre später entstand auch in Wanne eine derartige Schule, in der die Kinder aus den Gemeinden Eickel, Röhlinghausen und Wanne unterrichtet wurden.
Die ersten zehn Jahre der Wanner Schule sind durch häufigen Lehrerwechsel gekennzeichnet, da die jüdische Gemeinde nicht die finanziellen Mittel besaß, einen Lehrer fest einzustellen. Erst nachdem 1907 die Synagogengemeinde gegründet worden war, konnte man an die dauerhafte Einstellung eines Lehrers denken. Wie in vielen anderen kleinen Synagogengemeinden musste der Lehrer auch alle anderen Arbeiten der Gemeinde verrichten. Im Klartext hieß das, dass er nicht nur acht Schulstufen in einer Klasse zu unterrichten hatte, sondern auch als Kantor in der Synagoge vorsingen, die Protokolle des Synagogenvorstandes schreiben und die Synagoge putzen musste. Trotz der wenig attraktiven Aussicht bewarben sich bei der Stellenausschreibung im April 1909 fast dreißig Lehrer um die Stelle. Die Arbeitslosigkeit unter den jüdischen Lehrern war sehr hoch, da die meisten nichtjüdischen Schulen sich weigerten, sie einzustellen. Nach einigen Probegottesdiensten, die pädagogischen Fähigkeiten wurden nicht geprüft, entschied sich die Gemeinde für Josef Rosenbaum, der bis zu seiner Ermordung durch die Nazis das Gemeindeleben entscheidend prägte.
So schreibt der israelische Bildjournalist Dr. Kurt Meyerowitz über seine Zeit bei Lehrer Rosenbaum: ‚In die Schule mussten wir sauber gewaschen und angekleidet gehen, unsere Ausdrucksweise musste gepflegt sein. Die jüdische Volksschule hatte im Ganzen ein Klassenzimmer, in dem jeweils 20 bis 30 Kinder in 5 verschiedenen Klassen lernten. Die untersten 4 Klassen waren sozusagen die Vorbereitung für das Gymnasium für die Jungs und für das Lyzeum für die Mädchen. Dann gab es noch eine fünfte Klasse, in der die Kinder bis zum achten Schuljahr lernten, die keine Aussicht hatten, eine höhere Schule zu besuchen, sei es, weil die Eltern nicht das Geld dazu hatten, sei es, dass sie nicht begabt genug waren, um die Aufnahmeprüfung der höheren Schule zu bestehen. Unser Lehrer war der Vorbeter und Prediger der Synagogengemeinde gleichzeitig. Dadurch wurde er zu einer Respektsperson für die Kinder. Er war auch wohl ein hervorragender Pädagoge. Wenn er einer Klasse den entsprechenden Lehrstoff beibrachte, wurden die anderen Klassen gleichzeitig beschäftigt, indem er die Aufsicht jeweils einem Kind übergab, das irgendwie die anderen Kinder ausstach. Oft war es ein Kind derselben Klasse, oft ein Kind der nächsthöheren. Wenn ich – auch in den späteren Jahren – den Ausdruck hörte ‚es geht hier zu wie in einer Judenschule‘ habe ich den erst begriffen, als ich eine Talmud-Thora-Schule erlebte, in der das gemeinsame laute Lesen und Lernen üblich ist. Bei uns in der Schule war es mäuschenstill. Es gab in unserer Schule auch gemeinsame Stunden wie Turnen und Singen. Wir lernten zu der Geige unseres Lehrers Volkslieder, patriotische Lieder und hebräische Gebetslieder‘.
Die von Meyerowitz beschriebene Tendenz, dass viele jüdische Familien sich bemühten, ihre Kinder auf weiterführende Schulen zu schicken, führte zu einem allmählichen Rückgang der Schülerzahl nach 1911. Auch der Schulweg über die Kaiser-Wilhelm-Straße (heute: Am Alten Amt) zur Synagoge in der Langekampstraße hielt durch seine Gefährlichkeit einige Eltern ab, ihre Kinder dort beschulen zu lassen. ‚Wer schon beobachtet hat, wie die kleinen israelitischen Schulkinder, die diese Straße als Schulweg benutzen müssen, in großer Lebensgefahr schweben, von Automobilen, Postwagen und anderen Fuhrwerken überfahren zu werden, der muss sich wundern, dass nicht schon größeres Unglück geschehen ist. Mit ängstlichem Schreien klammern sich die armen Kinder an die Gartenzäune. Auch die Vorsicht, Dienstboten zur Begleitung mitzugeben, nützt hier nicht viel, denn der Begleiter ist derselben Gefahr ausgesetzt wie das Kind. Es sind Fälle bekannt, wo auch Erwachsene auf die Mauer klettern mussten, um nicht überfahren zu werden‘.
Als in den 1920er Jahren die konfessionsfreie Diesterwegschule öffnete, ließen einige jüdische Familien ihre Kinder diese Schule besuchen. Mangels Schüler stellte die jüdische Volksschule 1924 ihren Unterricht ein. Acht jüdische Schüler besuchten in diesem Jahre die Diesterwegschule. Lehrer Rosenbaum wurde an die gleiche Schule versetzt, wo er später zum Konrektor befördert wurde. Doch nach einigen Jahren entstand in der jüdischen Gemeinde wieder der Wunsch nach einer eigenen Volksschule, in der auch wieder Religionsunterricht und Hebräisch auf dem Lehrplan stehen sollten. 1929 nahm die Schule ihren Betrieb wieder auf. Da Lehrer Rosenbaum an der Diesterwegschule bleiben wollte, übernahm Max Fritzler die Stelle des Lehrers. Nach dem Wechsel Rosenbaums zur Diesterwegschule war Fritzler 1924 nach Wanne-Eickel gekommen, um die Stelle des Kultusbeamten zu übernehmen und den jüdischen Religionsunterricht an den weiterführenden Schulen zu erteilen. Sowohl auf dem Oberlyzeum wie auf dem Realgymnasium in Wanne strebten zahlreiche jüdische Schüler die Reifeprüfung an. Im Jahre 1911 besuchten 13 jüdische Schüler das Realgymnasium, 1928 waren es noch zehn und nach 1933 lassen sich keine jüdischen Schüler mehr nachweisen.

Das Oberlyzeum Wanne-Eickel, das die jüdischen Mädchen besuchten, die das Abitur machen wollten, hatte seinen jüdischen Schülerinnen gegenüber eine offene Einstellung. Dies zeigen die erhaltenen Abiturarbeiten und die eingereichten Lebensläufe, in denen die Schülerinnen auch zu innerjüdischen Problemen Stellung nahmen. Auch ein ausgeprägtes soziales und politisches Bewusstsein dokumentiert sich in diesen Arbeiten. Dazu sei angemerkt, dass ohne ein tolerantes Lehrerkollegium freimütige Äußerungen religiöser, sozialer und politischer Art wohl nicht niedergeschrieben worden wären. Die weiterführenden Schulen für Mädchen wurden augenscheinlich gerne von jüdischen Schülerinnen besucht. Die Quote der jüdischen Mädchen, die eine weiterführende Schule in Herne oder Wanne-Eickel besuchten, war höher als die bei den anderen Konfessionen. Auch der Vergleich zwischen jüdischen Mädchen und Jungen fällt zahlenmäßig zugunsten der Schülerinnen aus. Während der Anteil jüdischer Schüler 1932 an der Oberrealschule bei 1,2 % und auf dem Realgymnasium bei 2,1 % lag, hatte das Oberlyzeum einen Anteil von 3,6 % jüdischer Schülerinnen. Mit dem Eintritt in eine weiterführende Schule verließen die jüdischen Kinder die beschützte Abgeschlossenheit der jüdischen Gemeinde und wurden mit antisemitischen Lehrern und Schülern konfrontiert, wie folgender Bericht von Meyerowitz zeigt: ‚In der Quinta hatte ich meine erste Begegnung mit Antisemitismus. Wir hatten einen Erdkunde-Lehrer, der in einer Stunde auch über Handwerke in aller Welt sprach und dabei versicherte, dass Juden nur Händler, Kaufleute oder Bankiers seien. Trotzdem ich eigentlich nie auf die Art Antisemitismus aufmerksam gemacht wurde, die Juden als Händler und Schmarotzer anprangerte, waren wir als Kinder doch hellhörig, wenn von Juden in irgendeiner herabwürdigenden Weise gesprochen wurde; ich erzählte davon zu Hause. Onkel ‚Katz‘ wurde gerufen. Ich musste wortwörtlich erzählen, was er in der Schule vor den Kindern gesagt hatte. Lehrer Theiss erhielt einen langen Brief von Onkel Katz, in dem dieser von Pädagoge zu Pädagoge ihm schrieb, welche Wirkung auf unbefangene, aber in diesem zarten Alter leicht beeinflussbare Kinder solche Äußerungen haben. Nach Erhalt des Briefes kam Lehrer Theiss in unser Haus, sprach mit meinen Eltern und Onkel, und in der nächsten Stunde sprach er auch über die jüdischen Handwerker, den Schuhmacher Wolff auf der Bahnhofstraße, die Fleischer Philipp und Leeser, über Schneider in Gelsenkirchen. Ich habe von dieser Episode zwei Dinge gelernt und behalten: Das eine war die Achtung vor Handwerk jeder Art und die Kenntnis, dass es ehrbare jüdische Handwerker aller Art gab, das andere war, dass man sich nicht schämen muss, einen Fehler einzugestehen, der wegen ungenauer und fehlender Kenntnis durch unvorsichtiger Äußerung entstanden ist. Lehrer Theiss, der selbst einen Sohn auf unserer Schule hatte, hat durch die vornehme Art, in der er seinen Fehler auch vor der Klasse zugab, meine höchste Achtung erworben‘.
Waren, wie bei diesem Erlebnis, in der Kaiserzeit noch einige Menschen bereit, ihre antisemitischen Vorurteile zu überdenken, verhärtete sich nach der Gründung der ersten nationalsozialistischen Ortsgruppe in Wanne 1920 eine antisemitische Einstellung auch bei jungen Menschen, wie Meyerowitz darlegt: ‚Wer der Urheber meines niederdrückenden Erlebnisses war, ist der ganzen Klasse klar gewesen. Werner König (so war sein Name) wurde von der Klasse von da an geschnitten. Er blieb sowieso sitzen. Aber auf meinem Pult fand ich eines Tages ein Hakenkreuz eingeritzt. Es war der Beginn der antisemitischen Hetzezeit. Es gab wohl nur noch einen Antisemiten in der Klasse, der das getan haben konnte. Ich war in der Klasse aber wohl wegen meiner Untat einerseits, andererseits, weil ich ein sehr guter Turner und Schwimmer war, sehr beliebt und habe sonst nie wie ein paar jüdische Mitschüler unter Anpöbeleien zu leiden gehabt‘.
Die jüdischen Schüler mussten auf den weiterführenden Schulen außer dem offiziellen Lehrstoff auch lernen, auf die politische Einstellung ihrer Mitschüler und Lehrer zu achten: ‚Der ‚Direx‘ war ein hervorragender Pädagoge, absolut gerecht, und ich verehrte ihn. Ich hatte eigentlich eine strenge Zucht von ihm erwarten müssen, und das aus zwei Gründen. Der Erste war seine politische Einstellung. Er war – und er betonte das bei vielen Gelegenheiten, ‚deutschnational‘ eingestellt, was damals eine Neigung zum Antisemitismus besagte (den er offensichtlich aber nicht akzeptierte), und zweitens hatte ich ihm zwei Jahre vorher einen gemeinen Streich gespielt‘, erinnert sich Meyerowitz.
Neben den Schulen wurden auch die übrigen Kultur- und Bildungsinstitutionen der beiden Städte von der jüdischen Bevölkerung gern in Anspruch genommen. Der 1. Vorsitzende der Synagogengemeinde Herne, Moritz Gans, war bis zur NS-Zeit ein Förderer des Herner Heimatmuseums und der Forschungsarbeiten Karl Brandts.
Ein besonderes Engagement der Herner Juden lässt sich im Musikleben dieser Stadt vor dem Ersten Weltkrieg feststellen. Damals besuchten bis zu zwanzig jüdische Schülerinnen und Schüler das Herner Konservatorium, um dort Klavier oder Geige zu erlernen. Einige von ihnen musizierten in der Herner Konzertgesellschaft, die gerade von jüdischen Kaufleuten finanziell unterstützt wurde. Trotz aller Gefahren besuchten während der Zeit der Weimarer Republik bis zu 52 (1925) jüdische Kinder die weiterführenden Schulen in Herne. Nach der Machtübernahme 1933 setzte sich der Herner Oberbürgermeister Albert Meister (ein Lehrer, der wegen seiner faschistischen Aktivitaten 1931 aus dem Schuldienst entlassen worden war) im preußischen Landtag vehement dafür ein, dass die jüdischen Schülerinnen und Schüler die weiterführenden Schulen verlassen mussten. So nahm die Zahl jüdischer Schülerinnen und Schüler an diesen Schulen schnell ab und die der jüdischen Volksschulen entsprechend zu. In der Reichpogromnacht 1938 bereiteten die Nazis den jüdischen Schulen in beiden Städten ein schauriges Ende. Danach gab es in Wanne-Eickel nur noch drei jüdische Schulkinder, die nun die Schulen in Gelsenkirchen oder Bochum besuchen mussten. In Herne stellte der Arzt Dr. Gustav Wertheim sein Haus in der Heinrichstraße 6 als Schule zur Verfügung, doch als die Nationalsozialisten ihn 1941 in den Tod trieben, konnte auch hier kein Unterricht mehr stattfinden.
Nachdem die jüdischen Kinder, die nicht mehr fliehen konnten, von den Nazis in die Vernichtungslager deportiert worden waren, wurden nun die sogenannten „Halb- und Vierteljuden“ unter den Schulkindern herausgesucht. Dabei ging die Herner Polizei zum Teil härter als die Gestapo gegen die Kinder vor. Ein Vater berichtet aus dieser Zeit: „Die Gestapo gestattete meiner Frau, dass die Kinder keinen Judenstern tragen brauchten, dass sie normale Lebensmittelkarten empfangen und auch die Schule weiter besuchen durften. Trotzdem forderte K. (ein Herner Polizeirat, Anmerkung des Verfassers) meine Frau auf, sofort wieder Kennkarten für Juden für meine Kinder zu beantragen und Judensterne zu tragen…..obwohl K. bekannt sein musste, welches Schicksal den Kindern drohte, wenn sie als Juden weiter geführt würden.“
Kurt Tohermes
Aus: Sie werden nicht vergessen sein – Geschichte der Juden in Herne und Wanne-Eickel, Eine Dokumentation zur Ausstellung im Stadtarchiv Herne vom 15. März bis zum 10. April 1987, Hrsg. Der Oberstadtdirektor der Stadt Herne, 77 Seiten, Herne 1987, Seiten 40 bis 45 – Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Stadt Herne.