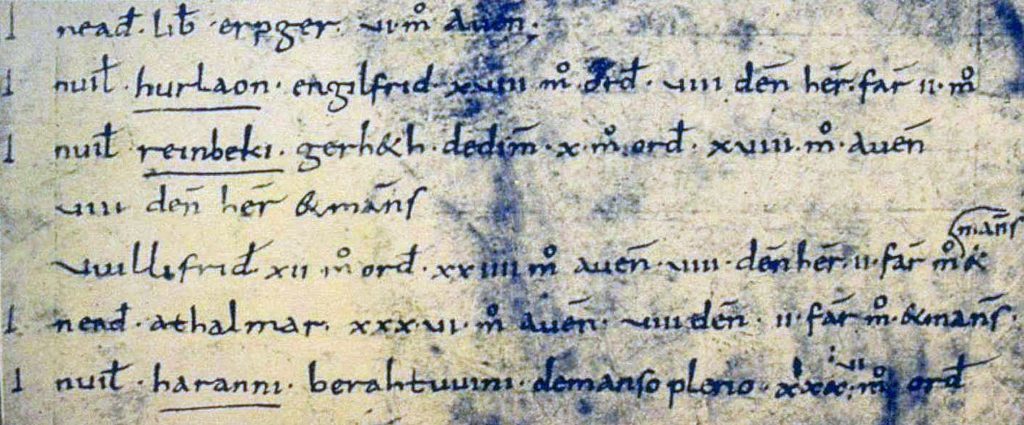SV Sodingen gegen Westfalia Herne – Malocherverein gegen Lackschuhklub. Was Rivalität über Zugehörigkeit aussagt. Eine Spurensuche
„Ich bin ein begeisterter Kinogänger. Aus diesem Grund kann ich den Reiz des Herner Lokalderbys auch nur mit dem wildesten Gangsterfilm vergleichen, von dem ich noch nächtelang träumte“, bekannte ein Leser der Hemer WAZ im Februar 1955. Mit dieser Beichte stand „W.U., Rudolfstraße“ keineswegs allein: Derby – das bewegte in den 1950er Jahren die Stadt bis ins Mark. Schon Tage vorher gab es im Betrieb, beim Friseur oder in der Kneipe nur ein Thema, geisterten aktuelle Wasserstandsmeldungen über die sportliche Form der Spieler durch die örtlichen Presseorgane. Im Verständnis der Grün-Weißen basierte die Rivalität auf klaren sozialen Bekenntnissen: ihr „Kumpelverein“ gegen den „Lackschuhklub“ Westfalia, die Malochermannschaft gegen die besser gestellte „Prominentenelf“, der benachteiligte Vorort gegen die hofierte Kaufmannschaft. Schließlich hatte man zu dieser Zeit den Eindruck, dass ein echter Sodinger von einer weit entfernten Stadt sprach, wenn er nach Herne fuhr.
An Sonntagen, wenn der SVS die Konkurrenz aus Herne empfing, erlebte der gesamte Ortsteil einen Besucheransturm, der heute nicht mehr vorstellbar ist. Die Hauptverkehrsader zwischen Herne und dem ehemaligen Amt Sodingen war die Mont-Cenis-Straße, auf der von 1906 bis 1959 auch die Straßenbahn verkehrte. Zusätzlich wurden ab 1952 Busse eingesetzt, um dem modernen Straßenverkehr Rechnung zu tragen. Ich stellte mir vor, wie die Vielzahl der Zuschauer sich in Straßenbahnen und Busse am Anfang der Mont-Cenis-Straße drängten, sofern sie bereit waren, den Fahrpreis von 30 Pfennig zu entrichten. Trotzdem waren sie übervoll, so dass man Schwierigkeiten hatte, überhaupt mitgenommen zu werden. Wer sich das Geld lieber sparen wollte und auch kein Auto besaß, ging zu Fuß bis zum Stadion. Jenen Weg, den ich an einem Sonntag im März 2012 gehe. Welche Spuren der alten Zeit lassen sich noch finden?

Zuerst kommen mir entlang der Mont-Cenis-Straße die Gaststätten in Erinnerung, die sich über mangelnden Bierumsatz nicht beklagen konnten. Bereits an der Ecke Hermann Löns-Straße befand sich das „Haus Fegbeitel“, es folgten das „Goethe Eck“, an der Einmündung zur Stammstraße die Gaststätte „Jäger“, etwas weiter auf der rechten Seite die „Enge Weste“. „Blau-Weiß“ oder „Grün-Weiß“ war an jeder Theke der Stadt die entscheidende Frage. Dabei rekrutierte sich die Anhängerschaft des SVS nicht nur aus dem eigenen Stadtteil. Der 2009 verstorbene Steiger Hans Hansch wohnte zentrumsnah in der Goethestraße und erinnerte sich an die Gründe seiner fußballerischen Parteinahme: „Ich war Bergmann auf der Zeche Friedrich der Große. Es war selbstverständlich, dass ich als Zechenangehöriger für den SV Sodingen schwärmte. Schließlich fühlt man sich als Bergmann einem reinen Zechenverein zugehörig. Die Heimspiele habe ich mir häufig angesehen. Zusammen mit meinem damaligen Kumpel Heinz Großmann bin ich mit der Straßenbahn zum Stadion am Holzplatz gefahren. Die Straßenbahn war völlig überfüllt. Wir sind von der Endstation bis zum Stadion gelaufen, da es nicht weit war. Meistens war der Platz bereits ausverkauft, so dass ich dem Platzordner zwei Mark extra in die Hand drückte, damit er uns überhaupt reinließ. Auf dem Platz standen die Zuschauer dicht gedrängt bis zu den obersten Rängen. Man hatte manchmal wirklich Mühe, überhaupt etwas vom Spiel zu sehen.“
Im September 1955 erlebte ein junger Torhüter aus dem Dortmunder Vorort Husen sein Debüt in der Glück-Auf-Stadion: Hans Tilkowski, der gerade von SuS Kaiserau zur Westfalia gekommen war. Noch heute hat der Vizeweltmeister von 1966 die Atmosphäre dieses Spiels vor Augen: „Es ging 4:4 aus. Acht Tore in der Oberliga erlebte man nicht alle Tage. Ich kam von außerhalb und wurde unvermittelt in dieses Derby-Stahlgewitter hineingeschmissen. Die Auseinandersetzungen mit Sodingen hatten immer einen besonderen Charakter. Es waren enge Spiele mit erhitzten Gemütern, oftmals ein harter Kampf auf Biegen und Brechen, Verletzte waren keine Seltenheit. Die Verrücktesten dabei waren Kurt Sopart und Hännes Adamik. Wenn die beiden weinten, liefen bei dem einen blau-weiße und bei dem anderen grün weiße Tränen.“ Und weil in diesen Zeiten bereits im Vorfeld klar war, dass das Derby an diesem Herner Sportsonntag alles andere in den Schatten stellen würde, sagte der Herner Fußballkreis regelmäßig sämtliche Partien der Kreisklassen ab.



Über die Kreuzung Hölkeskampring, wo wenige Meter entfernt Hans Tilkowski lebte, führt mein Weg weiter zum Stadion. Ich passiere eine mietskasernenartige Wohnsiedlung an der rechten Seite, eine unattraktive rote Backsteinfassade, Holzfenster, einfache Holztüren. Früher wohnten hier vornehmlich die Kumpel der im Umkreis befindlichen Zechen, zuweilen auch Angestellte oder Arbeiter aus Bergbauzulieferbetrieben. Die Tage dieser Wohnsiedlung scheinen mittlerweile gezählt. Etliche Wohnungen stehen bereits leer.1
Im Bezirk Sodingen angekommen, entdecke ich an der Ecke Mont-Cenis-Straße/Auf dem Rohde eine verwitterte Leuchtreklame in Form eines großen A. Hier befand sich vormals die Barbara-Apotheke. Ihr Name verrät, dass der Ortsteil durch den Bergbau geprägt war – die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Die Apotheke gehörte jahrelang dem früheren 1. Vorsitzenden des SV Sodingen, Klaus Liemke.
An der Aschekippe
Die alte Glück-Auf-Kampfbahn befand sich in Höhe der heutigen Mont-Cenis-Straße 218-228. Ich suche allerdings vergebens nach Überresten, die mich an den alten Sportplatz erinnern könnten. Auf dem Gelände sind in den 1970er Jahren ein Kindergarten sowie Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen gebaut worden. Ich gehe in die Stichstraße nach rechts direkt auf das Gelände des ehemaligen Platzes. Hinter Gebüschen an einem Spielplatz finde ich ein Relikt vergangener Tage: die Grenzmauer zur alten Platzanlage ist teilweise noch vorhanden und dient den umliegenden Grundstücken als Abgrenzung. Der Platz, den ich nur von Fotos kenne, wurde bereits 1923 durch die Zeche Mont Cenis errichtet. Es war ein Aschenplatz, der seitlich leicht aufgeschüttet war. Anfang der 1950er Jahre entsprach diese „Aschenkippe« nicht mehr den zeitlichen Anforderungen. Rund 5.000 freiwillige Arbeitsstunden brachten Vereinsmitglieder auf, um 6.000 Kubikmeter Erde zu bewegen, das Spielfeld zu vergrößern und das Fassungsvermögen von 10.000 auf 16.000 Zuschauer zu erhöhen. Nur derjenige, der weiß, dass hier einmal ein Sportplatz gewesen ist, kann sich vorstellen, in welch beengten Verhältnissen damals Fußball gespielt wurde.



Einen Steinwurf vom alten Sportplatz entfernt wohnte bis zu seinem Tod im Jahr 2005 Hännes Adamik, die große Symbolfigur des SVS. Sein Haus in der Liebigstraße 4c ist ein typisches Zechenhaus, „viergeteilt“. Zwei Eingänge befinden sich an der rechten Seite, zwei an der linken. Zugehörig waren kleinere Gärten, von denen je zwei nach vorne und zwei nach hinten gelegen sind. Kurzentschlossen schelle ich bei „Adamik“. Ehefrau Renate Adamik öffnet mir die Tür und bittet mich erfreut herein. Das Haus ist immer noch so eingerichtet wie zu Lebzeiten ihres Mannes. Ich habe den Eindruck, er könnte jederzeit durch die Tür hereinkommen und wir plaudern über die „gute alte Zeit“. In diesen vier Wänden scheint die Zeit stillzustehen und Geschichte bewahrt zu werden. Hännes Adamik besaß eine große Sammlung mit Fotos, Zeitungsausschnitten und anderen Erinnerungsstücken zur Geschichte des SVS. Aber ganz in der Tradition des alten Kämpen sieht es die Familie nicht gern, wenn Fremde nach Einsicht drängen.
Ich gehe zurück zur Mont-Cenis-Straße und erreiche nach kurzer Zeit die ehemalige Haltestelle Denkmal, die sich in Höhe der Gaststätte „Haus Wiesmann“ befand. Hier war eine „Ausweiche“ für die Straßenbahnen vorhanden, da die Schienenführung insgesamt einspurig war und sich somit an dieser Stelle zwei Straßenbahnen begegnen konnten, um entweder die Fahrt in Richtung Herne oder Castrop-Rauxel fortzusetzen. Das „Haus Wiesmann“ ist das frühere Vereinslokal des SV Sodingen und Treff ganzer Generationen von Bergleuten, Taubenzüchtern und Fußballverrückten. Immer mittwochs fand hier ein Stammtisch ehemaliger „Püttrologen“ statt und nach einigen Pils und Korn kommen die staubigen Geschichten aus dem Kohlerevier auf den Tisch: „Mont Cenis, Mont Cenis, diesenPütt vergess‘ ich nie.“2



In Richtung Amtshaus erkenne ich auf der rechten Seite eine alte, verwitterte Reklame, die in besseren Zeiten für Farbe warb. Was waren das früher für geschäftige Zeiten! Eine Fülle von Lebensmittelläden, Metzgereien, Friseuren, Bekleidungsgeschäften, Möbelläden und zwei Kinos waren vorhanden. Der Ortsteil war autark, so dass sich die Einwohner nicht zum Einkaufen nach Herne oder Castrop-Rauxel begeben mussten. Zwischenzeitlich sind die meisten Geschäftslokale geschlossen oder anderweitig besetzt, teilweise wurden auch Häuser abgerissen. Ich passiere die alte Mont-Cenis-Hauptverwaltung, die sich an der rechten Seite befindet und jetzt als Praxis und Wohngebäude genutzt wird. Von der Schachtanlage ist nicht mehr viel zu sehen. Es ist ein völlig neuer Stadtkern entstanden, auf dem ehemaligen Zechengelände stehen die Fortbildungsakademie sowie ein Stadtteilzentrum mit verschiedenen Geschäften und Wohnungen. Lediglich die Markenkontrolle in der direkten Zufahrt zur Zeche ist komplett erhalten. Dort ist eine Gedenktafel angebracht, die auf den historischen Kontext verweist.
Das Lebensgefühl des alten Reviers
Jetzt biege ich nach rechts in die Max-Wiethoff-Straße ein. In diesen Nebenstraßen in Zentrums- und Stadionnähe waren viele Gaststätten beheimatet; das Vereinslokal, in dem die Spieler mit ihren Fans beim Bierchen standen, das Verkehrslokal, in dem dienstags nach dem Training gekegelt wurde. Das „Deutsche Haus“, Am Kricken 6, ist nahezu im ursprünglichen Zustand erhalten, allerdings ist die Gaststätte schon seit Jahren geschlossen. An der Wand eines Hauses hat eine alte, mit Schlegel und Eisen versehene „Consum“-Reklame überdauert. Das Lebensgefühl des alten Ruhrgebiets mit der prägendenden Nähe der Kolonien und Zechensiedlungen hat sich in die Häuserzeilen In der Falsche und Am Kricken geradezu eingeschrieben. „Man kannte eigentlich jeden. Ich wurde an jeder Ecke angesprochen, wobei stets über das letzte Spiel gesprochen wurde und bereits über die Erwartungshaltung für das kommende Spiel. So liefen alle Gespräche ab“, erinnerte sich Leo Konopczynski in einem der letzten Gespräche, das ich vor seinem überraschenden Tod im Jahr 2003 mit ihm führte. Auch auf das Lokalderby blickte er damals mit einer gewissen Altersmilde: „Montags gingen wir öfter in die Gaststätte Ömmes Knapp nach Herne-Mitte und trafen dort viele Spieler von Westfalia, unter anderem Kurt Sopart oder Günter Grandt. Bemerken möchte ich, dass die Rivalität, die zwischen dem SV Sodingen und Westfalia Herne so aufgebauscht wurde, eigentlich unter uns Spielern gar nicht existierte. Dies ist teilweise von außen erzeugt worden.“ Konopczynski wohnte in der Händelstraße 38, direkt gegenüber der Wiege des Vereins, der Gaststätte „Haus Ropertz“.


Das Gebäude, unmittelbar an der Ecke zur Saarstraße gelegen, befindet sich in einem guten Zustand, die Gaststätte firmiert unter „Haus Wenzel“ und dient heute wieder als Vereinslokal.3
Über die Gerther Straße erreiche ich den Kurt-Edelhagen-Platz. Der Bigband-Leader hatte mit seiner swingenden Tanzmusik den Soundtrack zum Sodinger Fußballwunder geliefert, obwohl in den heimatlichen Kneipen eher der konventionelle Jukebox-Schlager angesagt war. Während die Grün- Weißen im Mai 1955 um die Deutsche Meisterschaft kämpften, träumte ganz Paris von der Liebe, jedenfalls laut Caterina Valente, die mit diesem Hit monatelang die Nummer eins der deutschen Hitparade besetzte. Entdeckt hatte die Sängerin kein geringer als Kurt Edelhagen, der Junge aus Börnig.
Auf dem Platz steht das Amtshaus im Originalzustand. Gerdi Harpers residierte dort in den 1950er Jahren. Sein bequemer Bürojob war eine städtische Gefälligkeit gegenüber dem unbequemen Vorortverein. Harpers erledigte Papierkram, stellte Pässe aus und sah einfach schnittig aus. Danach diente das Amtshaus bis in die 1990er Jahre als örtliches Polizeirevier und ist nunmehr ein beliebter Jugendtreff. An der Rückseite des Gebäudes befand sich der Schaukasten des Vereins, in dem Spielberichte und Tabellenstände ausgehangen wurden. Zwar ist der Kasten seit Jahren demontiert, aber die Dübellöcher und die Konturen sind für den Eingeweihten gut sichtbar. Auch das „Büdchen“ ist unverändert vorhanden. Bei Heimspielen strömten die Zuschauer hier vorbei, so manche DAB- oder Schlegel-Bierflasche ist hier geleert worden. Sie nennt sich heute Heike’s Büdchen. Allerdings stehen dort keine Bergleute mehr, die nach getaner Schicht den Kohlenstaub mit Bier und Korn herunterspülen. Wahrzeichen des Platzes ist der Hochbunker, der zwischenzeitlich freundlich gestrichen wurde, sein bedrohendes Element jedoch zu keinem Zeitpunkt verloren hat.


Am Ziel des Spaziergangs
Ich bin jetzt fast am Ziel meines sonntäglichen Spaziergangs angekommen. In Höhe der Ringstraße wende ich mich nach links, um über den alten Fußweg zum Stadion zu gehen. Heutzutage wird die Mont-Cenis-Straße auf ihrer Achse von Süden nach Norden durch die Sodinger Straße durchtrennt. Dies war bis in die 1960er Jahre nicht der Fall, so dass die Platzanlage über verschiedene Fußwege zugänglich war. Der Fußweg ist erhalten und wird lediglich von der Sodinger Straße gekreuzt. Von der Ringstraße aus kann man direkt auf den zwischenzeitlich aufgegeben Haupteingang des Platzes sehen, die obligatorischen Kassenhäuschen wurden demontiert. Der vordere Eingangsbereich wirkt ungepflegt und wird nur zu Lagerzwecken genutzt. Die alte Geschäftsstelle und die Umkleidekabinen sind nahezu im Ursprungszustand erhalten, auch was die graue Farbe betrifft. Allerdings wird der Platz nunmehr über die Straße „Am Holzplatz“ erschlossen, weil dort die Parkplätze angelegt wurden.
Die beeindruckenden Zechen-Schächte 2/4, die auf den alten Pressefotografien unmittelbar hinter dem Platz zu erkennen waren, sind seit langer Zeit verschwunden. Stattdessen befindet sich dort eine adrette Wohnbebauung. Von ihren Fenstern im zweiten Geschoss aus können die Anwohner sonntags Landesliga-Fußball für lau sehen; nicht dass nicht unten kein Platz mehr frei wäre, bei Heimspielen zählt man heutzutage selten mehr als 100 Zuschauer.
Vier Jahre lang blieben die Grünen von Mont Cenis in der Oberliga West gegen die Männer vom Schloss Strünkede ungeschlagen, aber in der Saison 1958/59 setzte es dann gleich zwei Niederlagen, wobei besonders das 1:4-Heimdebakel am 12. April 1959 wegweisend war. Doppeltorschütze Gerd Clement & Co. schickten als bereits feststehende Westmeister den SVS definitiv Richtung 2. Liga West. Im Vorfeld hatte die überregionale Sportpresse über eine mögliche „Schiebung“ orakelt, was aber nur zeigte, wie wenig man in Münster oder Köln die Intensität des Herner Prestigeduells verstand. Noch einmal hatte sich das übliche Verkehrschaos an der Ringstraße zugetragen, standen die Fahrzeuge in langen Reihen entlang aller Straßen in Stadionnähe, und zwar aus allen Richtungen kommend, sowohl von Castrop-Rauxel als auch von Herne-Mitte, Noch einmal hatte sich ein extra eingerichteter polizeilicher Ordnungsdienst zumeist vergebens darum bemüht, die Parksituation so zu regeln, dass wenigstens ein Durchkommen möglich war.
Jedes Heimspiel war wie Kirmes
Am Ende des Nachmittags schlendere ich ungestört wieder zurück Richtung Herne-Mitte. Sodingen hat das Heimspiel gegen SC Weitmar 45 gewonnen, 120 Zuschauer wurden gezählt. Auf der Mont-Cenis-Straße 331 fällt mir eine verlassene „Bude“ auf. Früher standen hier die Menschen Schlange, um nach dem Spiel ein schnelles Stehbier zu trinken und in hitzigen Diskussionen das gesehene Spiel zu verarbeiten. Für die Betreiber war jedes Heimspiel wie Kirmes, der entscheidende Wochenumsatz wurde an einem Tag gemacht. Jetzt ist der Ort verwaist, die Bude seit Jahren geschlossen, Efeu überwuchert das Mauerwerk. Spätestens 1962, nach Aufstieg und Wiederabstieg der Grün-Weißen, waren die glorreichen Fußballtage des SVS vorbei, aber auch insgesamt sollte der Herner Fußball nie wieder diese Extraklasse erreichen. Erst 30 Jahre später kreuzten sich erneut die Wege der beiden Kontrahenten zu einem Liga-Spiel, damals in der viertklassigen Verbandsliga. „Viertklassigkelt“, darüber rümpften anno 1990 die Adamiks, Konopczynskis und Harpers die Nase. Aus heutiger Sicht klingt diese selbst wie ein Traum.
Wolfgang Bruch4
Anmerkungen
- Die Häuser sind mittlerweile dem Zeitgeschmack entsprechend saniert und renoviert worden. Jürgen Hagen, Mai 2020. ↩︎
- Die Traditionsgaststätte wurde wegen der Neugestaltung des Platzes im Jahr 2015 abgerissen. Jürgen Hagen, Mai 2020. ↩︎
- Im Oktober 2015 schloss die Traditionskneipe nach 105 Jahren endgültig ihre Pforten. Jürgen Hagen, Mai 2020. ↩︎
- Erstveröffentlichung des Textes in: „Der Komet des Westens. Die Geschichte des SV Sodingen“. Seiten 145 bis 151. Adhoc Verlag, Herne 2012. Veröffentlichung von Text und Bildern auf dieser Seite mit freundlicher Genehmigung des Autors. ↩︎