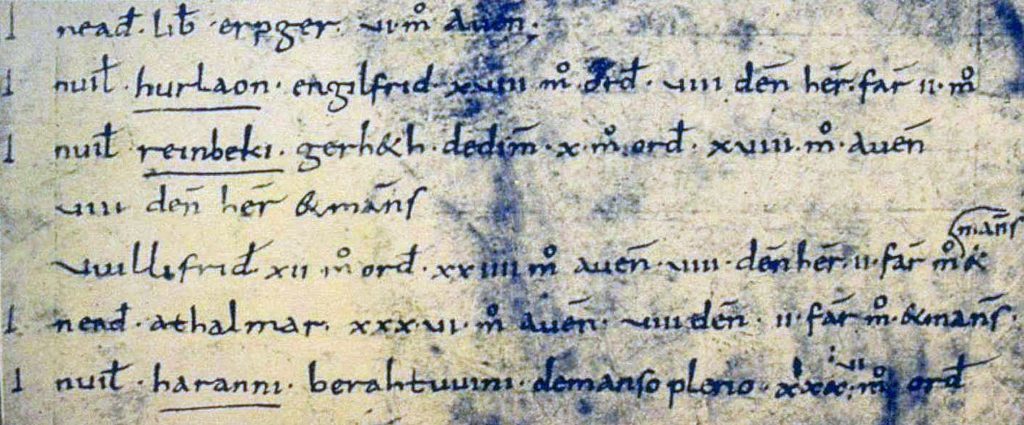Hernes Zentrum blieb im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen weitgehend verschont. Die Häuser im Geschäfts- und Behördenviertel standen und hatten nur Dach- und Fensterschäden erlitten. Die Unversehrtheit des Stadtkerns rief bei den Besatzungssoldaten Erstaunen hervor. Sie sprachen – in Anlehnung an den Film Die goldene Stadt aus dem Jahre 1942 – von Herne als „the golden town“. 1952 wurde der Herner Stadtkern in der Presse gar als „Kö des Ruhrgebietes“ bezeichnet.

Mit der Zeit aber blätterte das Gold ab und mit dem Wiederaufbau in den Nachbarstädten hatte es sich mit der Kö. Es zeigten sich die Nachteile: triste Hinterhöfe, verrottete Straßenzüge, rissige Stuckfassaden. Im Kerngebiet überwogen überalterte Gebäude mit unzureichenden Wohnverhältnissen. Mehr als 20 Prozent der Wohnungen im Stadtgebiet waren überaltert. Von allen Städten der Bundesrepublik Deutschland wies Herne über Jahre hinweg die höchste Abwanderungsquote an Einwohnerinnen und Einwohnern aus. Im Gleichschritt mit der Strukturkrise im Bergbau verschärfte sich die Lage.

In dieser Situation beschloss der Rat, durch eine gezielte, in mehreren Phasen durchgeführte Stadtentwicklung, diesen Trend umzukehren. Mit Hilfe eines „Entwicklungsplanes Stadtkern“, aktiver, freiwilliger Bürgerbeteiligung und mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW sollte Herne eine „echte“ City erhalten und so wieder attraktiver Wohn- und Arbeitsort werden. Die Vorbereitungen begannen im Jahr 1964. Der im Rahmen des Flächennutzungsplanes aufgestellte „Entwicklungsplan
Stadtkern“ gliederte sich in vier Planungszielen:
Erstes Planungsziel war die Herausnahme des Autoverkehrs aus den Hauptgeschäftsstraßen, verbunden mit dem Ausbau von Umgehungsstraßen und der Ausweisung von konzentrierten Parkflächen. Mit dem Bau der U-Bahn 35 sollte die Voraussetzung geschaffen werden, eine „echte“ Einkaufsstraße zu schaffen.
Zweites Planungsziel war die Standortauswahl und der Bau eines Kulturzentrums, dass die Stadtbücherei und die Volkshochschule sowie eine Veranstaltungsbühne beheimaten sollte. Das Kulturzentrum wurde – zentral an der Holsterhauser Straße, Ecke Berliner Platz gelegen – im September 1976 eröffnet. Herne hatte mit der multifunktionalen Halle endlich ein Haus für Konzerte und Theatergastspiele, aber auch für Messen, Kongresse, Parteitage und gesellige Veranstaltungen.
Drittes Planungsziel war der Ausbau des Hauptgeschäftsbereiches entlang der Fußgängerzone mit Anordnung von Verweilplätzen im Bereich des Bahnhofsplatzes, des neuen Stadtwerkehauses und an der evangelischen Kreuzkiche.
Viertes und grundsätzliches Planungsziel war die Stadtkernerneuerung. Als unzumutbar angesehene Wohnbebauung sollte saniert sowie die Gewerbeflächen renoviert und erweitert werden. Die Gesamtstruktur der Innenstadt sollte durch die Bildung eines neuen Kerns gehoben werden.
Damit entsprach das als „Herner Modell“ bekannt gewordene Sanierungskonzept in seinen Grundzügen ganz der Entwicklungsprogrammatik, die Ende der 1960er Jahre eigens zur Behebung der ruhrgebietstypischen Strukturdefizite entworfen worden war.
Im August 1969 wurde an der Neustraße das erste Sanierungsbüro der Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen (LEG) eingerichtet. Bereits kurze Zeit später waren drei Mitarbeiter für den regelmäßigen Beratungsdienst nötig. Die Stadtkernsanierung wurde populär und nahm Anfang 1970 ihren Lauf. Federführend für die Umsetzung des „Herner Modells“ war Stadtplaner Manfred Leyh. In einem Artikel in der Bürger-lllustrierten Unsere Stadt, Ausgabe 1-75, antwortete er auf die Frage, was aus der Sanierungsprojekt geworden sei: „Eine Freiluftakademie für Stadterneuerung!”
Für diese Freiluftakademie war man nicht zimperlich. Das alteingesessene Hotel Schlenkhoff wich dem Stadtwerkehochhaus, das alte Amtsgericht an der Bahnhofstraße musste dem City-Center weichen und der historische Dorfkern rund um den Kraft-Messing-Platz wurde zugunsten der vierspurigen Sodinger Straße abgerissen.
Symbolisch fiir die Stadtkernerneuerung stehen die 1976 am ehemaligen Steinweg, jetzt An der Kreuzkirche zwei bezugsfertig gewordenen Wohntürme, die für Aufsehen sorgten. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 4. Januar 1975 meinte: „Ein turmhohes Superhaus sprengt Herner Dimensionen“. Damals waren die Türme, die vom Herner Architekten Gerald Baschek entworfen wurden, ein Vorzeigeprojekt moderner Architektur. Es gab zahlreiche Interessenten für eine Wohnung in den Türmen. Heute eher nicht.


Die Stadtkernerneuerung wird mittlerweile kritisch betrachtet. Hernes ehemaliger Baudezernent Jan Terhoeven meinte in einem in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 29. Dezember 2010 veröffentlichten Interview recht rustikal: „Ein Wahnsinn. Was der Zweite Weltkrieg nicht geschafft hatte, hat damals die Stadtebauförderung geschafft.”
Jürgen Hagen, Erstveröffentlichung des ursprünglichen Textes: „125 Jahre (Alt-)Herner Stadtwerdung“. Jürgen Hagen. In: „Der Emscherbrücher“ Band 19 (2023/24). Seiten 7 bis 36 . Herausgegeben von der Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel e. V. Herne 2023.